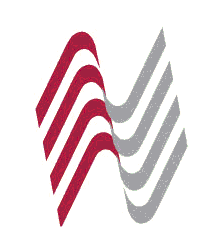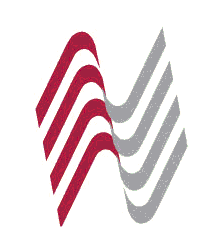News
| Amtsgericht Stade mit neuer Homepage |
08.04.2005 |
Das Amtsgericht Stade hat seinen Internetauftritt neu gestaltet. Es gehört damit - neben u.a. dem Justizministerium, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und dem Justizvollzug - zu den ersten Justizbehörden, die ihre Internetseiten auf ein künftig landesweit zu nutzendes System umgestellt haben.
Die übrigen Justizbehörden Niedersachsens werden kurz- und mittelfristig "nachziehen".
Für den Nutzer hat die niedersachsenweit einheitliche Gestaltung der Internetauftritte der Behörden den Vorteil, dass er sich leichter orientieren kann und alle angebotenen Informationen in derselben Weise übersichtlich geordnet vorfindet.
Die Adresse der neuen Homepage des AG lautet:
www.amtsgericht-stade.niedersachsen.de
|
|
|
|
|
| Kein Schadensersatz für Rettungsdienst bei grob fahrlässiger "Blaulichtfahrt” |
08.04.2005 |
Fahrer von Rettungsdiensten haben sich bei Rettungsfahrten grundsätzlich auch an Verkehrsregeln zu halten. Verstoßen Sie dagegen, kann dies einen Schadensersatzanspruch verringern. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Landgerichts Osnabrück.
Im vorliegenden Fall führte ein Mitarbeiter der Klägerin, die einen Rettungsdienst betreibt, am 09.03.2004 mit einem Rettungsfahrzeug der Klägerin, einem Daimler Chrysler Sprinter einen Einsatz von Dinklage nach Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) durch. Der Zeuge näherte sich gegen 8.55 Uhr in Quakenbrück dem Kreuzungsbereich Bürgerstraße/Minister-Karl-Möller-Straße mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht. Die Ampelanlage zeigte für ihn rot. Zur gleichen Zeit näherte sich auf der Bürgerstraße von links zunächst ein Postauto, das die Kreuzung überquerte. Dahinter fuhr die Beklagte. Auch sie beabsichtigte, die Kreuzung zu überqueren. Für sie zeigte die Ampelanlage grün. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.
Vorprozessual hatte die hinter der Beklagten stehende Versicherung unter Berücksichtigung einer Haftungsquote von 25 % einen Betrag von 9.575,61 Euro gezahlt. Mit der Klage verlangte die Klägerin Zahlung weiterer 37.429,54 Euro. Sie vertrat die Ansicht, die Beklagte hätte den Unfall allein verursacht. Ihr Fahrer hätte bei der Anfahrt auf die Kreuzung die Geschwindigkeit verringert, habe die Kreuzung eingesehen und festgestellt, dass der Verkehr zum Stehen gekommen sei. Sodann habe er beschleunigt und die Kreuzung überqueren wollen. Die Beklagte hat behauptet, der Fahrer sei mit unverminderter Geschwindigkeit in die Kreuzung hineingefahren.
Das Landgericht hat die Klage nach der Vernehmung des Fahrers und der Einholung eines Unfallrekonstruktionsgutachtens abgewiesen und zur Begründung folgendes ausgeführt:
Fahrer von Notarztwagen seien von der Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) befreit. Sie dürften folglich bei rot in Kreuzungsbereiche einfahren. Dennoch behalte in solchen Situationen der nach der allgemeinen Regelung Vorfahrtsberechtigte - hier die bei Grünlicht fahrende Beklagte - grundsätzlich sein Vorfahrtsrecht. Dieses würde nur durch das Sonderrecht des Rettungsfahrers beschränkt.
Demnach dürften Fahrer von Rettungsfahrzeuge das Vorfahrtsrecht anderer Verkehrsteilnehmer nur unter Anwendung größtmöglichster Sorgfalt mißachten. Die Vorrechte dürften erst ausgeübt werden, wenn der Fahrer sich vergewissert hätte, dass die anderen Verkehrsteilnehmer sein Vorrecht erkannt und sich auf die Durchfahrt des Einsatzfahrzeuges eingerichtet hätten. Ein Einsatzfahrer verhalte sich dagegen grob fahrlässig, wenn er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich hineinfahre, obwohl er wegen Sichtbehinderung nicht feststellen könne, ob die Signale des Einsatzfahrzeugs von allen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen und beachtet würden.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist das Gericht zum einen zu der Erkenntnis gekommen, dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, ca. 57 km/h, in die Kreuzung eingefahren ist. Ein Abbremsen im Kreuzungsbereich ist dabei offensichtlich nicht erfolgt. Der als Zeuge vernommene Fahrer hat dies gegenüber dem Gericht zwar so angegeben, diese Aussage konnte aber durch die Auswertung der Diagrammscheibe widerlegt werden.
Des weiteren waren die Sichtverhältnisse an der Kreuzung aufgrund der Bebauung stark eingeschränkt. Die links einmündende Straße, aus der sich die Beklagte näherte, konnte der Fahrer des Rettungsfahrzeugs erst beim Einfahren in den Kreuzungsbereich einsehen.
Nach Auffassung des Gerichts hat der Fahrer insgesamt grob fahrlässig gehandelt. Dieser sei mit überhöhter Geschwindigkeit in den ausgesprochen unübersichtlichen Kreuzungsbereich hineingefahren, ohne sich vorher zu vergewissern, dass Verkehrsteilnehmer sein Vorrecht erkannt hatten. Hinzu käme noch, dass vor der Beklagten noch ein Postauto die Kreuzung überquert hatte. Schon dies hätte für den Zeugen Anlass sein müssen, darauf zu achten, ob noch weitere Verkehrsteilnehmer aus dieser Richtung kommen.
Ein schuldhafter Pflichtverstoß seitens der Beklagten konnte durch die Kammer dagegen nicht festgestellt werden. Der Sachverständige, der die Unfallstelle in Augenschein genommen hatte, hat gegenüber dem Gericht ausgeführt, dass ein auf der Ecke der Kreuzung stehendes Mehrfamilienhaus für die Beklagte zum einen eine Sichtbehinderung, gleichzeitig aber auch eine Schallbeeinträchtigung darstellte. Deshalb konnte das Gericht nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgehen, dass die Beklagte das Martinshorn überhaupt wahrnehmen konnte, zumal eine unbeteiligte Unfallzeugin, die zu Fuß aus der gleichen Richtung kam, wie die Beklagte, angegeben hat, sie habe auch kein Martinshorn gehört. Eine etwaige Mitverursachung an dem Unfall seitens der Beklagten sei deshalb unter Berücksichtigung der bereits vorprozessual geleisteten Zahlung ausreichend berücksichtigt.
Die Entscheidung ist rechtskräftig. |
|
|
|
|
| Altersversorgung eines ehemaligen Beamten auf Vertragsbasis unzulässig |
08.04.2005 |
Scheidet ein Beamter auf eigenen Antrag aus dem Staatsdienst aus, verliert er kraft Gesetzes seine Ansprüche auf eine spätere beamtenrechtliche Altersversorgung. Diese Ansprüche können ihm auch nicht vertraglich erhalten werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Der Kläger stand bis Anfang 1987 als Beamter (Senatsdirektor) im Dienst des beklagten Landes, schied dann auf eigenen Antrag aus dem Staatsdienst aus und trat auf Wunsch des Landes in den Vorstand einer Werft ein, um diese auch im Interesse des Landes aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten herauszuführen. Das Land sicherte ihm vertraglich zu, ihm nach der Beendigung seiner Tätigkeit bei der Werft für die Zeit als Beamter eine Versorgung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zu gewähren und dabei auch die Zeit der Tätigkeit bei der Werft versorgungssteigernd zu berücksichtigen. Nach der Beendigung seiner Tätigkeit zahlte ihm das Land zunächst die zugesagte Versorgung, stellte die Zahlung dann jedoch ein, weil die vertraglichen Voraussetzungen entfallen seien. Die Klage des Klägers blieb in allen Instanzen erfolglos.
Das Gesetz verbietet es, einem Beamten höhere als die gesetzlich zustehenden Versorgungsbezüge zu zahlen. Das Verbot gilt auch, wenn der Beamte auf eigenen Antrag aus den Diensten seines früheren Dienstherrn ausgeschieden ist. In diesem Falle stehen ihm nach dem Gesetz keinerlei Versorgungsansprüche zu. Sie können auch nicht vertraglich vereinbart werden. Stattdessen muss er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert werden. Der Fall unterscheidet sich von der rechtlich zulässigen Möglichkeit, mit einem Arbeitnehmer zivilrechtlich zu vereinbaren, ihn nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach beamtenrechtlichen Grundsätzen zu versorgen. Im Falle des Klägers ging es nicht um die Begründung eines neuen zivilrechtlichen Dienstverhältnisses zu seinem ehemaligen Dienstherrn und eines damit verbundenen Versorgungsanspruchs, sondern allein um die Erhaltung des mit der Entlassung untergegangenen beamtenrechtlichen Anspruchs.
Auf Grund der vom Berufungsgericht festgestellten Umstände des Einzelfalls besteht auch kein Schadensersatzanspruch des Klägers gegen seinen ehemaligen Dienstherrn.
BVerwG 2 C 5.04 – Urteil vom 7. April 2005 |
|
|
|
|
| Bundesgerichtshof bejaht Anspruch des Vermieters auf Kostenvorschuß des Mieters für Schönheitsreparaturen |
08.04.2005 |
Der u.a. für das Wohnungsmietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hatte sich mit der Frage zu befassen, ob der Vermieter während eines laufenden Mietverhältnisses vom Mieter Zahlung eines Kostenvorschusses für die Durchführung vertraglich übernommener Schönheitsreparaturen verlangen kann, wenn der Mieter damit in Verzug ist. Der Senat hat dies in Fortführung seiner früheren Rechtsprechung zum Gewerberaummietrecht bejaht.
Der Beklagte ist Mieter einer Wohnung im Hause der Klägerin. Im Mietvertrag aus dem Jahre 1958 ist bestimmt, daß die Schönheitsreparaturen vom Mieter getragen werden. Bestimmte Fristen für die Durchführung der Arbeiten sind nicht vereinbart worden. Mit der Klage hat die Klägerin den Beklagten auf Zahlung eines Kostenvorschusses von Höhe von ca. 13.000 € zur Vornahme von Schönheitsreparaturen in Anspruch genommen. Der Beklagte hat bisher trotz entsprechender Aufforderungen keine Schönheitsreparaturen in der angemieteten Wohnung ausgeführt. Die Wohnung ist renovierungsbedürftig, der Aufwand für die Renovierung beläuft sich nach einem vorgelegten Kostenvoranschlag auf den eingeklagten Betrag.
Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landgericht hat auf die Berufung der Klägerin das erstinstanzliche Urteil abgeändert und den Beklagten zur Zahlung des Vorschusses verurteilt.
Der Senat hat das Urteil des Landgerichts bestätigt. Er hat dabei zunächst auf sein Urteil aus dem Jahre 1990 (BGHZ 111, 301) Bezug genommen. In jener Entscheidung hat der Senat für einen Fall der Gewerberaummiete ausgesprochen, daß der Vermieter – sofern der Mieter die Pflicht zur Durchführung von Schönheitsreparaturen übernommen hat – auch während des laufenden Mietverhältnisses die Vornahme solcher Reparaturen vom Mieter verlangen kann. Der Senat hat in seiner heutigen Entscheidung klargestellt, daß dies auch für die Wohnraummiete gilt und daß der Anspruch des Vermieters mangels eines Fristenplanes fällig wird, sobald die Mietwohnung bei objektiver Betrachtungsweise renovierungsbedürftig ist. Dies gilt unabhängig davon, ob infolge bislang unterlassener Renovierungen bereits die Substanz der Wohnung gefährdet ist. Damit hat der Senat verschiedentlich anderslautende Entscheidungen der Instanzgerichte nicht gebilligt.
Wenn der Mieter seiner Pflicht zur Renovierung nicht rechtzeitig nachkommt, kann der Vermieter einen Vorschuß in Höhe der voraussichtlichen Kosten verlangen und die Maßnahme selbst durchführen.
Urteil vom 6. April 2005 – VIII ZR 192/04
AG Charlottenburg - 226 C 64/03 ./. LG Berlin - 64 S 27/04
Karlsruhe, den 6. April 2005 |
|
|
|
|
| Anlegerschutz bei der Göttinger Gruppe |
08.04.2005 |
Der für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte erneut über mehrere Klagen von Kapitalanlegern gegen Gesellschaften der sog. Göttinger Gruppe zu entscheiden. Die Göttinger Gruppe hat in den 90er Jahren über 100.000 Anleger geworben, mit denen die verschiedenen Gesellschaften des Konzerns jeweils stille Gesellschaftsverträge geschlossen haben. Die eingezahlten Gelder sollten in Immobilien und Unternehmensbeteiligungen angelegt werden. Die Anleger waren am Gewinn, aber auch am Verlust beteiligt. Nach Ablauf von etwa drei Jahren wurde von der jeweiligen Gesellschaft im Namen des Anlegers ein neuer Gesellschaftsvertrag geschlossen, bezogen auf ein neu aufgelegtes "Unternehmenssegment". Die weiteren Zahlungen des Anlegers flossen dann in das neue Segment, während der alte Vertrag beitragslos gestellt wurde. Das sollte sich bis zum Ende der Gesamtvertragslaufzeit – je nach Wahl des Anlegers bis zu 40 Jahre – wiederholen (sog. Steiger-Modell). Durch diese gestaffelten Beteiligungen sollte erreicht werden, daß die Anleger immer an einem Unternehmenssegment beteiligt waren, das sich gerade in der Anfangsverlustphase befand und daher steuerliche Verlustzuweisungen ermöglichte. Eine Besonderheit bestand darin, daß am Ende der Laufzeit die dann vorhandenen Guthaben nach Wahl der Anleger nicht in einer Summe, sondern als monatliche Rente ("SecuRente") ausgezahlt werden sollten. Der stehen bleibende Restbetrag sollte jeweils mit 7 % pro Jahr verzinst werden.
Dieses Rentenmodell konnte nicht verwirklicht werden, weil das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen im Oktober 1999 der Göttinger Gruppe unter Hinweis auf Bestimmungen des Kreditwesengesetzes untersagte, die Auseinandersetzungsguthaben in Form von Renten auszuzahlen. Daraufhin verpflichtete sich die Göttinger Gruppe im Rahmen eines mit dem Bundesaufsichtsamt geschlossenen Prozessvergleichs, die Guthaben jeweils in einer Summe an die Anleger zu zahlen. Den Wegfall der Rentenzahlung haben eine Anzahl von Anlegern zum Anlass genommen, ihre Beteiligung zu kündigen. Andere verlangen Rückzahlung ihrer Einlagen mit der Begründung, sie seien bei den Beitrittsgesprächen über die wahren Risiken der Anlage getäuscht worden.
Der Senat hat festgestellt, daß die von den Anlegern geschlossenen Gesellschaftsverträge grundsätzlich wirksam sind. Die Anleger können ihre Beteiligung aber mit sofortiger Wirkung kündigen. Der Kündigungsgrund liegt in der Ankündigung der Göttinger Gruppe, die Guthaben künftig nur noch in einer Summe auszuzahlen. Da damit die versprochene Verzinsung wegfällt, ist den Anlegern die Fortsetzung der Verträge nicht zumutbar. Sie haben aufgrund der Kündigung einen Anspruch auf sofortige Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens, also des Wertes, den ihre Beteiligung zur Zeit hat.
Wirtschaftlich wichtiger ist die Frage, ob die Anleger unabhängig von dem gegenwärtig noch bestehenden Wert ihrer Beteiligung die von ihnen gezahlten Einlagen in voller Höhe zurückverlangen können. Das hängt nach den Entscheidungen des Senats davon ab, ob der einzelne Anleger bei dem Vertragsschluß nicht ordnungsgemäß über die Nachteile und Risiken der Anlage aufgeklärt worden ist. Bei Verträgen, die nach dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden sind, hat der Senat einen solchen Aufklärungsmangel bereits darin gesehen, daß den Anlegern die Rentenzahlung am Ende der Vertragslaufzeit als sicher dargestellt worden ist. Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen hatte sich auf den Standpunkt gestellt, die Rentenzahlung sei aufgrund einer Änderung des Kreditwesengesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 1998 unzulässig geworden. Ob das stimmt, hat der Senat offen gelassen. Er hat aber angenommen, daß die Anleger jedenfalls über die Unsicherheit der Rechtslage hätten informiert werden müssen.
Bei den Vertragsschlüssen aus der Zeit vor 1998 bestand diese Aufklärungspflicht noch nicht, weil nach der alten Fassung des Kreditwesengesetzes die Rentenzahlung zweifelsfrei zulässig war. Bei diesen Verträgen kommt es deshalb für den Erfolg der Klagen darauf an, ob die Anleger in bezug auf andere Umstände nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden sind. Zur Klärung dieser Frage sind einige der Verfahren an die Berufungsgerichte zurückverwiesen worden. Dort muß versucht werden, durch Vernehmung von Zeugen festzustellen, ob die Werber der Göttinger Gruppe den Anlageinteressenten die Risiken der Anlage verschwiegen oder dazu falsche Angaben gemacht haben. Den Berufungsgerichten ist auch aufgetragen worden zu prüfen, ob nach dem Anlagekonzept nur ein ganz geringer Teil der Anlegergelder für die Investitionstätigkeit bestimmt war und der weit überwiegende Teil die sog. weichen Kosten, wie etwa die Provisionen für die Werber und die allgemeinen Verwaltungskosten, abdecken sollte. In diesem Fall wäre ein Gewinn der Anleger unwahrscheinlich, ein Verlust dagegen wahrscheinlich gewesen. Auch darüber hätten die Anleger ggf. aufgeklärt werden müssen.
Urteile vom 21. März 2005 – II ZR 124/03, II ZR 140/03, II ZR 149/03, II ZR 180/03 und II ZR 310/03
LG Göttingen - 2 O 493/01 ./. OLG Braunschweig - 3 U 114/02
LG Göttingen - 8 O 255/01 ./. OLG Braunschweig - 3 U 37/02
LG Göttingen – 8 O 293/02 – OLG Braunschweig – 3 U 73/02
LG Göttingen - 2 O 516/01 und 2 O 66/02 ./. OLG Braunschweig - 3 U 112/02
LG Göttingen – 2 O 73/02 ./. OLG Braunschweig – 3 U 231/02
Karlsruhe, den 21. März 2005 |
|
|
|
|
| Aufklärungspflicht des Arztes über Nebenwirkungen von Medikamenten |
08.04.2005 |
Der u.a. für das Arzthaftungsrecht zuständige VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über die Frage der Hinweispflicht des behandelnden Arztes über schwerwiegende Nebenwirkungen von verordneten Medikamenten entscheiden.
Die Klägerin begehrt Schadensersatz nach einer ärztlichen Behandlung durch eine Gynäkologin. Diese verordnete der 1965 geborenen Klägerin, welche eine Raucherin war, im November 1994 das Antikonzeptionsmittel "Cyclosa", eine sog. Pille der dritten Generation, zur Regulierung ihrer Menstruationsbeschwerden. Die Klägerin nahm daraufhin das verordnete Medikament seit Ende Dezember 1994 ein. Im Februar 1995 erlitt sie einen Mediapartialinfarkt (Hirninfarkt, Schlaganfall), der durch die Wechselwirkung zwischen dem Medikament und dem von der Klägerin während der Einnahme zugeführten Nikotin verursacht wurde.
Ausweislich der dem Medikament beigefügten Gebrauchsinformation bestand bei Raucherinnen ein erhöhtes Risiko, an zum Teil schwerwiegenden Folgen von Gefäßveränderungen (z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall) zu erkranken. Dieses Risiko nahm mit zunehmendem Alter und steigendem Zigarettenkonsum zu. Deshalb sollten Frauen, die älter als 30 Jahre waren, nicht rauchen, wenn sie das Arzneimittel einnahmen.
Das Berufungsgericht hat einen Schadensersatzanspruch abgelehnt. Auf die Revision der Klägerin hat der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Er hat dazu ausgeführt:
Die Beklagte sei verpflichtet gewesen, die Klägerin über die mit der Einnahme des Medikaments verbundenen Nebenwirkungen und Risiken zu informieren. Unter den hier gegebenen Umständen reiche der Warnhinweis in der Packungsbeilage des Pharmaherstellers nicht aus. In Anbetracht der möglichen schweren Folgen, die sich für die Lebensführung der Klägerin bei Einnahme des Medikaments ergeben konnten und auch später verwirklicht haben, habe auch die Beklagte als das Medikament verordnende Ärztin darüber aufklären müssen, daß das Medikament in Verbindung mit dem Rauchen das erhebliche Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls in sich barg. Nur dann hätte die Klägerin ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich entweder dafür entscheiden können, das Medikament einzunehmen und das Rauchen einzustellen, oder wenn sie sich als Raucherin nicht in der Lage sah, das Rauchen aufzugeben, auf die Einnahme des Medikaments wegen des bestehenden Risikos zu verzichten.
Die Sache wurde an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil dieses zwar ebenfalls von einer bestehenden Aufklärungspflicht der Ärztin ausgegangen ist, aber mit einer widersprüchlichen Begründung, die der revisionsrechtlichen Prüfung nicht standgehalten hat, eine hypothetische Einwilligung der Klägerin in die Verordnung des Medikaments angenommen hat.
Urteil vom 15. März 2005 - VI ZR 289/03
LG Schwerin - 7 O 42/98 ./. OLG Rostock - 8 U 44/03
Karlsruhe, den 15. März 2005 |
|
|
|
|
| Geschlechterquote bei Betriebsratswahlen verfassungskonform |
08.04.2005 |
Die Regelungen in § 15 Abs. 2 BetrVG und § 15 Abs. 5 Nr. 2 WO sind nicht verfassungswidrig. Die in § 15 Abs. 2 BetrVG getroffene Anordnung, dass das im Betrieb vertretene Minderheitsgeschlecht entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein muss, und der in § 15 Abs. 5 Nr. 2 WO vorgesehene Listensprung verstoßen weder gegen den nach Art. 3 Abs. 1 GG bestehenden Grundsatz der Gleichheit der Wahl, noch wird dadurch in unzulässiger Weise in die durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistete Tarifautonomie eingegriffen. Das hat der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts in einem Wahlanfechtungsverfahren entschieden.
Bei der angefochtenen Betriebsratswahl in einem Nachfolgeunternehmen der Deutschen Post entfielen auf Frauen als Geschlecht in der Minderheit drei von neun Betriebsratssitzen. Um diese Sitze konkurrierte die Vorschlagsliste der Gewerkschaft ver.di mit der Vorschlagsliste der Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM). Bei Anwendung des d’Hondt’schen Höchstzahlverfahrens entfielen auf die Liste ver.di sieben Betriebsratssitze, auf die Liste DPVKOM zwei Sitze. Da auf der Liste DPVKOM keine Frauen kandidiert hatten, wurde einer der beiden auf die DPVKOM-Liste entfallenden Sitze der Liste ver.di zugeschlagen, so dass eine weitere Frau Betriebsratsmitglied wurde. Dagegen wandte sich die DPVKOM und verlangte die Berichtigung des Wahlergebnisses. Das Arbeitsgericht hat die Anträge zurückgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihnen im Wesentlichen entsprochen. Die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats und eines Betriebsratsmitglieds hatte vor dem Siebten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Ein Anspruch der DPVKOM auf Berichtigung des Wahlergebnisses besteht nicht, da dieses unter Zugrundelegung der wirksamen Regelungen in § 15 Abs. 2 BetrVG, § 15 Abs. 5 Nr. 2 WO zutreffend ermittelt wurde.
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 16. März 2005 - 7 ABR 40/04 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Köln, Beschluss vom 31. März 2004 - 3 TaBV 12/03 - |
|
|
|
|
| Abgeltung von Urlaub bei Blockfreistellung in der Altersteilzeit |
08.04.2005 |
Nach dem gesetzlichen Urlaubsrecht ist nicht gewährter Urlaub bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzugelten (§ 7 Abs. 4 BUrlG). Beginnt für einen Arbeitnehmer in Altersteilzeit die Blockfreizeit, so ist das keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Offene Urlaubsansprüche sind daher nach der gesetzlichen Regelung dann nicht abzugelten. Der Bundes-Angestelltentarifvertrag und der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit enthalten keine abweichende Regelung.
Eine Angestellte des öffentlichen Dienstes hatte ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis vom 1. Februar 2000 bis 31. Januar 2004 im sogenannten Blockmodell vereinbart. Danach sollte die Arbeitsphase vom 1. Februar 2000 bis zum 31. Januar 2002 und die Freistellungsphase vom 1. Februar 2002 bis zum 31. Januar 2004 dauern. Die Angestellte hatte ihren Urlaub für das Jahr 2001 bis auf vier Tage genommen; letzter Urlaubstag war der 21. September 2001. Ab dem 1. Oktober 2001 bis zum Beginn der Freistellung am 1. Februar 2002 war sie ununterbrochen arbeitsunfähig erkrankt.
Ihre Klage auf Abgeltung dieser vier Urlaubstage sowie des anteiligen Urlaubs für das Jahr 2002 blieb in allen Instanzen erfolglos. Das Risiko, dass ein Urlaub wegen andauernder Arbeitsunfähigkeit vor Beginn der Freistellungsphase nicht mehr eingebracht werden kann, trägt der Arbeitnehmer. Darin liegt keine unzulässige Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer im Blockmodell mit denjenigen, die während der Altersteilzeit durchgehend mit verringerter Arbeitszeit weiterarbeiten. Diese können bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Zweck der Urlaubsgewährung von ihrer Arbeitspflicht freigestellt werden.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15. März 2005 - 9 AZR 143/04 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin, Urteil vom 8. Oktober 2003 - 15 Sa 1006/03 - |
|
|
|
|
| Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Untätigkeit |
08.04.2005 |
Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Strafgefangenen gegen die
Untätigkeit des Landgerichts (LG) Hamburg in einer ihn betreffenden
Vollzugssache war erfolgreich. Die 1. Kammer des Zweiten Senats stellte
fest, dass die Untätigkeit des LG den Beschwerdeführer (Bf) in seinem
Recht auf effektiven Rechtsschutz verletzt.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer hatte bei der Justizvollzugsanstalt erfolglos die
Gewährung eines so genannten Schülerstatus zur Aufnahme eines
Fernstudiums an der Universität Hagen beantragt. Im Juli 2000 stellte er
in dieser Angelegenheit beim LG Hamburg Antrag auf gerichtliche
Entscheidung. Nachdem das LG diesen Antrag abgelehnt und der Bf
hiergegen Rechtsbeschwerde eingelegt hatte, hob das Oberlandesgericht
(OLG) mit Beschluss vom 11. September 2001 die Entscheidung des LG auf
und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung an das LG zurück. Im
Oktober 2001 vermerkte die damals zuständige Richterin beim LG, sie sehe
sich wegen starker Belastung nicht in der Lage, in der Sache eine
Entscheidung zu treffen. In der Folgezeit wechselte, wie dem Bf auf
Sachstandsanfrage mitgeteilt wurde, mehrfach die Besetzung der
betreffenden Richterstelle. Am 6. September 2002 legte der Bf beim LG
Untätigkeitsbeschwerde ein. Das LG leitete diese Beschwerde, ebenso wie
eine nachfolgende Sachstandsanfrage, nicht an das OLG weiter. Nachdem
der Bf eine erneute Sachstandsanfrage direkt dem OLG zukommen ließ,
forderte dieses die Akten vom LG an. Erst auf die dritte Anforderung des
OLG übersandte das LG die Verfahrensakten. Mit Beschluss vom 2. Januar
2003 stellte das OLG die Rechtswidrigkeit der Untätigkeit des LG fest.
Ungeachtet dessen traf das LG bisher keine Entscheidung in der Sache.
Mit seiner Vb rügt der Bf die Verletzung seines Rechts auf effektiven
Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG). Darüber hinaus beanstandet er, dass es
keinen wirksamen Rechtsschutz gegen eine derartige richterliche
Untätigkeit durch ein Fachgericht gebe. Er fordere deshalb, dass es von
Verfassungs wegen ermöglicht wird, das übergeordnete Fachgericht mit
Entscheidungsmacht auszustatten, gegen ein willkürlich untätiges
Untergericht vorgehen und selbst entscheiden zu können.
Auf Anfrage des Bundesverfassungsgerichts beim LG, ob mittlerweile eine
Entscheidung ergangen sei, und zweimaliger schriftlicher
Aktenanforderung erfolgte keine Reaktion. Erst nach mehrmaliger direkter
telefonischer Aufforderung des zuständigen Richters beim LG wurden die
Verfahrensakten dem Bundesverfassungsgericht zugeleitet.
Die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg erklärte, von einer
Stellungnahme abzusehen, wies aber darauf hin, dass der Bf allein im
Jahr seines streitgegenständlichen Antrags insgesamt 54
Vollzugsverfahren beim LG Hamburg anhängig gemacht habe.
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:
Das Grundgesetz (Art. 19 Abs. 4 GG) gewährleistet wirksamen
Rechtsschutz. Wirksam ist nur ein zeitgerechter Rechtsschutz. Gründe,
die es rechtfertigen könnten, dass auf den Beschluss des OLG vom 2.
Januar 2003 hin nicht alsbald eine Entscheidung getroffen wurde, liegen
nicht vor. Auf Umstände, die innerhalb des staatlichen
Verantwortungsbereichs liegen, kann sich der Staat zur Rechtfertigung
der überlangen Dauer eines Verfahrens nicht berufen. Welche
Verfahrensdauer noch angemessen ist, hängt von den Umständen des
Einzelfalles - unter anderem von der Bedeutung der Sache, den
Auswirkungen einer langen Verfahrensdauer für die Beteiligten, der
Schwierigkeit des Falles und dem Verhalten der Beteiligten - ab. Dem
Richter steht für die Bearbeitung anhängiger Verfahren grundsätzlich ein
Ermessensspielraum zu, innerhalb dessen er aufgrund eigener Gewichtung
solcher Faktoren Prioritäten in Abweichung von der Reihenfolge des
Eingangs setzen kann. Inwieweit dabei auch der Umstand, dass ein Kläger
die Justiz durch eine Vielzahl von Anträgen in besonderem Maße
beansprucht, Zurücksetzungen rechtfertigt, ist im vorliegenden Fall
nicht zu entscheiden. Jedenfalls besteht ein diesbezüglicher
Gestaltungsspielraum des Richters nicht mehr, wenn ein übergeordnetes
Gericht festgestellt hat, dass bereits die bisherige Untätigkeit in dem
betreffenden Verfahren rechtswidrig war.
Soweit sich die Vb dagegen wendet, dass auch im Falle festgestellter
rechtswidriger Untätigkeit eines Gerichts das übergeordnete Gericht
nicht die Möglichkeit hat, die festgestellte Rechtsverletzung zu
beenden, indem es die Entscheidung an sich zieht, ist sie unbegründet.
Der Bf wendet sich hier der Sache nach gegen ein Unterlassen des
Gesetzgebers. Durch die beharrliche Untätigkeit des LG im vorliegenden
Fall wird nicht belegt, dass bereits die gesetzlichen Rahmenbedingungen
nicht den Anforderungen aus Art. 19 Abs. 4 GG entsprechen. Verletzt ein
Gericht durch Untätigkeit seine Pflicht zur Gewährung effektiven
Rechtsschutzes, so bestehen neben der in vielen Fällen eröffneten
Möglichkeit der Untätigkeitsbeschwerde weitere Möglichkeiten, auf ein
pflichtgemäßes Verhalten der Justiz hinzuwirken.
Beschluss vom 29. März 2005 – 2 BvR 1610/03 –
Karlsruhe, den 7. April 2005 |
|
|
|
|
| Einstweilige Anordnung gegen automatisierten Abruf von Kontostammdaten abgelehnt |
08.04.2005 |
Die Antragsteller wenden sich gegen Regelungen zum automatisierten Abruf
von Kontostammdaten, der zu Zwecken der Erhebung von Steuern und
Sozialversicherungsbeiträgen sowie der Überprüfung der Berechtigung
für Sozialleistungen erfolgen kann. Ihr Antrag, die Regelungen vorläufig
auszusetzen, hatte keinen Erfolg. Der Erste Senat des
Bundesverfassungsgerichts lehnte den Erlass einer einstweiligen
Anordnung ab.
Rechtlicher Hintergrund und Sachverhalt:
Antragsteller sind ein inländisches Kreditinstitut, ein Rechtsanwalt und
Notar, eine Bezieherin von Wohngeld sowie ein Empfänger von
Sozialhilfe. Sie rügen die durch das Gesetz zur Förderung der
Steuerehrlichkeit vom 23. Dezember 2003 in die Abgabenordnung
eingefügten Vorschriften des § 93 Abs. 7 und Abs. 8 und des § 93 b als
verfassungswidrig. Die Neuregelung erlaubt den Finanzbehörden im
Steuerverfahren ab dem 1. April 2005 - im Anschluss an den Ablauf der so
genannten Steueramnestie - einen Zugriff auf bestimmte Daten, die von
den Kreditinstituten nach § 24 c des Kreditwesengesetzes vorgehalten
werden müssen. Dabei handelt es sich um die Kontostammdaten der
Bankkunden und sonstigen Verfügungsberechtigten, wie z.B. Name,
Geburtsdatum, Kontonummern und Depots. Kontenstände und -bewegungen
können auf diese Weise nicht abgefragt werden. Über die Finanzbehörden
erhalten auch andere Behörden der Sozialverwaltung und Gerichte
Auskunft, wenn die anfragende Behörde oder das anfragende Gericht ein
Gesetz anwendet, das an „Begriffe des Einkommensteuergesetzes“ (z.B.
Einkommen, Einkünfte) anknüpft und eigene Ermittlungen dieser Behörde
ihrer Versicherung nach nicht zum Ziel geführt haben oder keinen Erfolg
versprechen.
Das Bundesministerium der Finanzen hat am 10. März 2005 einen
Anwendungserlass zur Abgabenordnung verfügt. Dieser sieht unter anderem
vor, dass ein Abruf der Kontostammdaten zum Zwecke der Steuererhebung
nur anlassbezogen und zielgerichtet und unter Bezugnahme auf eindeutig
bestimmte Personen zulässig ist. Der Anwendungserlass regelt darüber
hinaus die Benachrichtigung der Betroffenen in verschiedenen
Verfahrensstadien. Für den Kontenabruf durch andere Behörden oder
Gerichte nimmt der Anwendungserlass eine Konkretisierung der vom Gesetz
betroffenen Bereiche der Sozialverwaltung vor. Für den Datenabruf ist
die Subsidiarität in der Weise vorgesehen, dass er nicht als
erforderlich angesehen wird, wenn es zur Aufklärung des Sachverhalts ein
ebenso geeignetes, aber für den Betroffenen weniger belastendes
Beweismittel gibt, etwa die Auskunft durch den Betroffenen.
Die Antragsteller rügen eine Verletzung ihres Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung, ihres Grundrechts auf Berufsfreiheit und ihres
Anspruchs auf Gewährung effektiven Rechtsschutzes.
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:
Der Ausgang der Verfassungsbeschwerde ist offen. Daher ist über den
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Wege einer
Folgenabwägung zu entscheiden. Wird die Aussetzung des Vollzugs eines
Gesetzes begehrt, ist dabei ein besonders strenger Maßstab anzulegen.
Bei der Folgenabwägung kann bedeutsam werden, ob von den Behörden auf
der Anwendungsebene Vorkehrungen getroffen wurden, die zu einer
Nachteilsbegrenzung führen. Die Folgenabwägung geht zu Lasten der
Antragsteller aus:
1. Bei Erlass einer einstweiligen Anordnung (und späterer
Erfolglosigkeit der Vb) würde den zuständigen Behörden und Gerichten
vorläufig ein Instrument genommen, das zum gleichmäßigen Vollzug von
Abgaben- und Sozialleistungsgesetzen beitragen soll. Die Gleichmäßigkeit
der Erhebung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowie die
Verhinderung des unberechtigten Bezugs von Sozialleistungen sind
gewichtige Gemeinwohlbelange. Bei hinreichendem Anlass können allerdings
schon bisher Auskünfte bei Kreditinstituten, insbesondere über konkrete
Kontostände und -bewegungen, verlangt werden. Dafür muss aber bekannt
sein, bei welchen Kreditinstituten der Steuerpflichtige Konten
unterhält. Diese Kenntnis wird durch die Abfrage der Kontostammdaten
erlangt. Die Möglichkeit zur Ermittlung zuvor nicht bekannter Konten und
Depots entfiele beim Erlass der einstweiligen Anordnung mit dem Risiko
des Fortbestandes von Vollzugsdefiziten im Steuer- und Sozialrecht.
2. Träte das angegriffene Gesetz dagegen am 1. April 2005 in Kraft,
wären die Behörden und Gerichte befugt, durch Abruf der Kontostammdaten
personenbezogenene Informationen zu gewinnen, die vorher nicht
zugänglich waren. Der daraus folgende Nachteil für den Steuerpflichtigen
besteht nicht darin, dass den Finanzbehörden auf diese Weise einzelne
der für die Besteuerung maßgebenden tatsächlichen Umstände bekannt
werden können und die Steuer dementsprechend nach den gesetzlichen
Vorgaben festgesetzt werden kann, sondern in der Kenntnis
personenbezogener Daten über das Bestehen von Konten und Depots, die zur
weiteren Ermittlung von steuererheblichen Tatsachen genutzt werden kann.
Die Steuerpflichtigen sind zwar ohnehin zur Offenlegung der
steuererheblichen Tatsachen verpflichtet, grundsätzlich aber nicht zur
Angabe von Konten. Daran ändert die Neuregelung nichts, erlaubt aber
eine Erkenntniserlangung über Konten und Depots ohne Mitwirkung des
Steuerpflichtigen. Die damit verbundenen Nachteile treten hinter die
zurück, die beim Nicht-In-Kraft-Treten des Gesetzes für die
Allgemeinheit zu erwarten wären, jedenfalls solange die im
Anwendungserlass verfügten Einschränkungen der Kontenabfrage beim
Gesetzesvollzug beachtet werden.
a) Die Schwere des Eingriffs für den Steuerpflichtigen hängt davon ab,
ob der Abruf der Kontostammdaten an einengende Tatbestandsmerkmale,
insbesondere an einen konkreten Anlass geknüpft ist. Das Gesetz schließt
die Ermittlung von Kontostammdaten "ins Blaue hinein" oder durch
anlasslosen rasterhaften Abgleich aller Konten aus. Für die Schwere des
Nachteils ist ferner erheblich, ob der Betroffene ausreichende
Rechtsschutzmöglichkeiten hat. Die Neuregelung knüpft die neuen
Ermittlungsbefugnisse an tatbestandliche Voraussetzungen, die auch sonst
bei finanzbehördlichen Ermittlungen gelten. Der vom Bundesministerium
der Finanzen verfügte Anwendungserlass zur Abgabenordnung konkretisiert
die Schutzvorkehrungen für die Betroffenen und schwächt damit die
möglichen Belastungen durch die neuen Ermittlungsbefugnisse ab. So
betont der Anwendungserlass, dass ein Abruf der Kontostammdaten nur
anlassbezogen und zielgerichtet und unter Bezugnahme auf eindeutig
bestimmte Personen zulässig ist. Die vorgesehenen Formulare erfordern
die Dokumentation des Abrufgesuchs und die Angabe des Aktenzeichens. Der
Anwendungserlass stellt im Übrigen grundsätzlich eine vorherige,
jedenfalls aber eine nachfolgende Information des Betroffenen sicher,
die es ihm erlaubt, Rechtsschutz zu erlangen. Zudem sehen die zurzeit im
Bundesfinanzministerium für Finanzen vorbereiteten Formulare eine
Dokumentation der Abrufmaßnahme vor.
b) Bei einem Kontoabruf im Besteuerungsverfahren eines
Berufsgeheimnisträgers trägt der Anwendungserlass einer möglichen
Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses zu Dritten Rechnung. Er
gebietet eine zusätzliche Güterabwägung zwischen der
Verschwiegenheitspflicht des Berufsgeheimnisträgers und der Bedeutung
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Ferner wird ausdrücklich untersagt,
dass Kontrollmitteilungen über Anderkonten der Berufsgeheimnisträger,
die in seinem Besteuerungsverfahren festgestellt werden, ergehen.
c) Auch im Hinblick auf die von den Auskunftsersuchen der Behörden der
Sozialverwaltung Betroffenen werden die möglichen Nachteile durch den
Anwendungserlass und die für das Ersuchen vorgesehenen Formulare
gemildert. Es ist davon auszugehen, dass die ersuchten Finanzbehörden
solchen Ersuchen keine Folge leisten werden, die den Anforderungen des
Anwendungserlasses und den für das Auskunftsersuchen vorgesehenen
Formularen nicht genügen.
Zwar ist der Abgabenordnung nicht zuverlässig zu entnehmen, welche
Bereiche der Sozialverwaltung betroffen sind. Der Anwendungserlass
benennt sie aber in abschließender Weise.
Im Hinblick auf die Gewährung effektiven Rechtsschutzes sorgen der
Anwendungserlass und ergänzend die Formulare für Korrektive. Das
Formular verlangt neben der Angabe des Aktenzeichens Erläuterungen zu
den Gründen des Ersuchens, darunter auch zu dessen Erforderlichkeit. Der
Anwendungserlass geht im Übrigen von der Annahme aus, dass der
Betroffene spätestens dann, wenn die Abfrage zu rechtlichen Folgen bei
der Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen oder der Festsetzung oder
Korrektur von Sozialleistungen führt, Kenntnis von ihr erlangt und die
Gerichte anrufen kann.
d) Die den Kreditinstituten durch die Abrufmöglichkeit drohenden
Nachteile sind ebenfalls nicht so gewichtig, dass eine einstweilige
Anordnung zu erlassen ist. Die mit der Nutzung der Datei für Zwecke des
Kontenabrufs verbundenen Kosten der Kreditinstitute sind vergleichsweise
gering. Da die Bank gegenüber ihren Kunden nicht treuwidrig handelt,
wenn eine Behörde kraft gesetzlicher Ermächtigung ohne Kenntnis und
Mitwirkung der Bank automatisiert Daten abruft, ist eine Verletzung des
vertraglichen Vertrauensverhältnisses nicht zu befürchten.
Beschluss vom 22. März 2005 – 1 BvR 2357/04 und 1 BvQ 2/05 –
Karlsruhe, den 23. März 2005 |
|
|
|
|
| Persönlichkeitsrecht schützt vor verdeckter Bildmanipulation |
08.04.2005 |
Die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers (Bf), der sich gegen die
technisch bearbeitete Abbildung seines Kopfes in einer Zeitschrift
wandte, war erfolgreich. Die 1. Kammer des Ersten Senats hob das
angegriffene Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) auf, da es den Bf in
seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt. Die Sache wurde an den
BGH zurückverwiesen.
Sachverhalt:
Der Bf war Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG. Im Jahre 2000
berichtete die Beklagte des Ausgangsverfahrens in einer von ihr
verlegten Zeitschrift über die wirtschaftliche Situation der Deutschen
Telekom. Sie illustrierte den Artikel mit einer Ablichtung eines Mannes
in einem Geschäftsanzug, der auf einem bröckelnden, magentafarbenem
großen „T“ sitzt. Die fotografische Abbildung des Kopfes des Bf ist im
Zuge einer Fotomontage auf den Oberkörper eines anderen Mannes gesetzt
worden. Dabei wurde die Abbildung des Kopfes technisch bearbeitet. Die
Intensität dieser Bearbeitung ist von den Gerichten nicht abschließend
aufgeklärt worden. Unstreitig ist der Kopf allerdings um ca. 5%
gestreckt worden. Der Beschwerdeführer ist trotz der Bearbeitung
eindeutig identifizierbar. Er sieht in der Veränderung eine
unterschwellige und negative Manipulation seiner Gesichtszüge.
Die in den ersten Instanzen zunächst erfolgreiche Unterlassungsklage des
Bf wurde vom BGH abgewiesen. Die hiergegen gerichtete
Verfassungsbeschwerde hatte Erfolg.
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:
Die Meinungsfreiheit umfasst die grafische Umsetzung einer kritischen
Aussage eines Zeitschriftenartikels auch durch eine satirisch wirkende
Fotomontage. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt aber vor der
Verbreitung eines technisch manipulierten Bildes, das den Anschein
erweckt, ein authentisches Abbild einer Person zu sein. Ein solcher
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht wird auch dann nicht durch die
Meinungsfreiheit gerechtfertigt, wenn das Bild in einen satirischen
Kontext gerückt wird.
Das für die Fotomontage benutzte Bild des Kopfes des Bf beansprucht,
eine fotografische Abbildung zu sein. Zugleich gibt es - anders als
typischerweise eine karikaturhafte Zeichnung - dem Betrachter keinen
Anhaltspunkt für die Manipulation der Gesichtszüge. Ein solcher Anhalt
folgt auch nicht daraus, dass die übrige Darstellung deutlich erkennbar
den Charakter des Fiktiven hat. Für die Abbildung des Kopfes gilt dies
gerade nicht.
Fotos suggerieren Authentizität und der Betrachter geht davon aus, dass
die abgebildete Person in Wirklichkeit so aussieht. Diese Annahme trifft
aber bei einer das Aussehen des Gesichts verändernden Bildmanipulation
nicht zu. Das Persönlichkeitsrecht schützt davor, dass ein
fotografisches Abbild, das Dritten zugänglich gemacht wird, manipulativ
entstellt ist. Die Bildaussage wird jedenfalls dann unzutreffend, wenn
das Foto über rein reproduktionstechnisch bedingte und für den
Aussagegehalt unbedeutende Veränderungen hinaus verändert wird. Solche
Manipulationen berühren das Persönlichkeitsrecht, einerlei ob sie in
guter oder verletzender Absicht vorgenommen werden oder ob der
Betrachter die Veränderung als vorteilhaft oder nachteilig für den
Dargestellten bewertet. Die in der bildhaften Darstellung in der Regel
mitschwingende Tatsachenbehauptung über das Aussehen des Abgebildeten
wird unzutreffend. Eine unrichtige Information ist unter dem Blickwinkel
der Meinungsfreiheit aber kein schützenswertes Gut. Dies gilt auch bei
der Verwendung von fotografischen Abbildungen in satirischen Kontexten,
wenn die Manipulation für den Betrachter nicht erkennbar ist und er
daher die Veränderung nicht als Teil der für satirische Darstellungen
typischen Verfremdungen und Verzerrungen deuten und damit für seine
Meinungsbildung bewertend einordnen kann.
Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt die Entscheidung des
BGH nicht. Der BGH stellt maßgeblich darauf ab, dass eine satirische
Bildaussage ganzheitlich zu erfassen und das Gesicht des Bf als
Bildbestandteil nicht gesondert zu berücksichtigen sei. Dieser Grundsatz
ist aber nicht anzuwenden, wenn der manipulierte Teil der Abbildung -
wie im konkreten Fall - einen eigenständigen Aussagegehalt hat. Dann
bedarf es einer eigenständigen Beurteilung unter dem Aspekt des
Persönlichkeitsschutzes. Diese wird der BGH noch vorzunehmen haben.
Beschluss vom 14. Februar 2005 – 1 BvR 240/04 –
Karlsruhe, den 22. März 2005 |
|
|
|
|
| Kein Zeugnisverweigerungsrecht für Verlobte |
13.03.2005 |
HANNOVER. Künftig sollen sich Verlobte nicht mehr vor einer Zeugenaussage drücken können. All zu häufig werde das sog. Zeugnisverweigerungsrecht missbraucht, um angebliche Verlobte vor einer unliebsamen Aussage zu schützen.
Das Zeugnisverweigerungsrecht für Verlobte ist nicht mehr zeitgemäß. Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Hindernis für die effektive Strafverfolgung entwickelt. Ein Verlöbnis wird schlicht behauptet, ist nirgends dokumentiert und kann von den Gerichten schwerlich überprüft werden.
Das Niedersächsische Justizministerium unterstützt deshalb den Gesetzentwurf zur Abschaffung des Zeugnisverweigerungsrechts für Verlobte und wird ihn als Mitantragsteller im Bundesrat einbringen.
§§ 52 I Nr. 1 StPO, 383 I Nr. 1 ZPO regeln gegenwärtig das Aussageverweigerungsrecht für Verlobte. |
|
|
|
|
| Begleitetes Fahren jetzt in ganz Niedersachsen |
13.03.2005 |
Erstes Bundesland mit landesweitem Modellversuch - Hirche: „Modell wird sehr gut angenommen“
Als erstes Bundesland hat Niedersachsen am heutigen Dienstag (01.03.) das "begleitete Fahren" landesweit eingeführt. "Die hohe Akzeptanz bei Fahranfängern und Eltern sind ein deutlicher Beweis: Das Modell für mehr Fahrsicherheit wird angenommen", sagte Verkehrsminister Walter Hirche. Die eigentlich für Ende letzten Jahres geplante Einführung wurde durch die Ankündigung des Bundesverkehrsministeriums, eine bundesweite Regelung zu schaffen, zurückgestellt. Ende Januar wurde die Vorlage, die von Niedersachsen gemeinsam mit weiteren interessierten Ländern und dem Bundesverkehrs- und Bundesjustizministerium erarbeitet wurde, überraschend im Verkehrsausschuss des Bundestages abgelehnt. "Eine Einführung des Modellversuchs ohne Ausnahmegenehmigungen ist damit in weite Ferne gerückt. Wir weiten ab heute unseren Versuch auf alle Regionen in Niedersachsen aus", sagte Hirche.
Mit der Einführung des Modellversuchs soll überprüft werden, ob die hohen Unfallzahlen bei Fahranfängern durch eine Begleitphase vor dem endgültigen Alleinfahren verringert werden kann. Andere Länder, wie Österreich und Schweden, haben durch dieses Modell die Unfallzahlen deutlich reduzieren können. In Niedersachsen sind in den 18 Pilotregionen seit April 2004 bereits rd. 6.000 Ausnahmegenehmigungen für den Modellversuch erteilt worden. Ca. 2.800 Fahranfänger haben ihre Fahrprüfung abgelegt und befinden sich in der "Begleitphase", 1.108 haben den Modellversuch bereits
abgeschlossen und ihren regulären Kartenführerschein erhalten. Bisher wurden lediglich drei leichte Blechschäden bei den Fahrten mit den Eltern registriert. Eine erste Auswertung zeigt eine Zustimmung von 91% bei Eltern und Fahranfängern. Nur bei insgesamt fünf Teilnehmern musste die Ausnahmegenehmigung zurückgezogen werden, da sie ohne Eltern gefahren sind.
Hintergrund:
Beim "begleiteten Fahren" können die Fahranfänger ihre reguläre Fahrausbildung ein Jahr früher als bisher beginnen. Ab dem 17. Lebensjahr darf dann, nach der normalen Führerscheinprüfung, bis zum 18. Lebensjahr nur in Begleitung der Eltern gefahren werden. Bundesweit wird diskutiert, ob auch Dritte Begleiter sein dürfen. Niedersachsen hat sich für die verschärfte Form entschieden und lässt nur die Erziehungsberechtigten (i.d.R. die Eltern) als Begleitpersonen zu, da diese durch die elterliche Sorge ohnehin für die Jugendlichen die Verantwortung tragen.
Die genauen Bedingungen sowie die Antragsformulare stehen im Internet unter
www.begleitetes-Fahren.de |
|
|
|
|
| Der Betrieb eines "Internet-Cafés" kann eine Spielhallenerlaubnis erfordern |
13.03.2005 |
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass für den Betrieb eines "Internet-Cafés" eine gewerberechtliche Spielhallenerlaubnis erforderlich sein kann. Eine derartige Erlaubnis braucht derjenige, der eine Spielhalle oder ein ähnliches Unternehmen betreiben will, das ausschließlich oder überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten oder Spielen mit Gewinnmöglichkeit oder der gewerbsmäßigen Aufstellung von Unterhaltungsspielen ohne Gewinnmöglichkeit dient. In dem in Berlin gelegenen Betrieb der Kläger wurden dem Publikum gegen Entgelt Computer zur Verfügung gestellt, die zu Internet-Recherchen und zur Kommunikation sowie zum Spielen genutzt werden konnten.
Derartige multifunktionale Geräte können im Sinne der Gewerbeordnung Unterhaltungsspiele ohne Gewinnmöglichkeiten sein. Die 1960 erfolgte Einführung einer Erlaubnispflicht für den Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens diente nicht zuletzt den Belangen des Jugendschutzes. Diesen Schutzzweck verfolgt der Gesetzgeber weiterhin, wie das Jugendschutzgesetz mit dem darin enthaltenen Verbot des Aufenthalts von Kindern und Jugendlichen in Spielhallen zeigt. Er erfordert immer dann die Durchführung eines Erlaubnisverfahrens, wenn der Betrieb durch die Bereitstellung von Computern zu Spielzwecken geprägt ist. So verhielt es sich nach den bindenden Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts in dem entschiedenen Fall.
BVerwG 6 C 11.04 – Urteil vom 9. März 2005 |
|
|
|
|
| Urteil im „Landser“-Verfahren rechtskräftig |
13.03.2005 |
rteil im „Landser“-Verfahren rechtskräftig
Das Kammergericht in Berlin hatte den Angeklagten R. als Rädelsführer einer kriminellen Vereinigung und wegen Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und weiteren Delikten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Nach den Feststellungen war der Angeklagte R. Bandleader der aus ihm und den beiden Mitangeklagten bestehenden Musikgruppe „Landser“. Die Band produzierte in dieser Besetzung bis zur Verhaftung ihrer Mitglieder im Jahre 2001 CDs mit Liedern überwiegend rechtsradikalen und nationalsozialistischen, insbesondere auch antisemitischen und ausländerfeindlichen Inhalts, die anschließend konspirativ in der rechten Szene vertrieben wurden. Während die beiden Mitangeklagten ihre Verurteilung zu Bewährungsstrafen nicht angegriffen haben, hat der Angeklagte R. Revision eingelegt.
Der für Staatsschutzverfahren zuständige 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat dieses Rechtsmittel mit Urteil vom heutigen Tag im wesentlichen verworfen. Er hat insbesondere die Annahme des Kammergerichts gebilligt, bei der Musikgruppe „Landser“ habe es sich, nachdem sie im Jahre 1997 mit den drei Angeklagten ihre endgültige Besetzung gefunden hatte, um eine kriminelle Vereinigung im Sinne des § 129 Abs. 1 StGB gehandelt, deren Tätigkeit darauf gerichtet war, durch die Herstellung und Verbreitung von CDs Straftaten wie Volksverhetzung, Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, Verunglimpfung des Staates etc. zu begehen. Der Schuldspruch war lediglich dahin abzuändern, daß die Verurteilung wegen öffentlichen Aufforderns zu Straftaten entfällt; denn insoweit fehlte es an tragfähigen Feststellungen. Auf die Strafe hatte dies keine Auswirkung, so daß die Revision im übrigen verworfen wurde.
Die Verurteilung aller drei Mitglieder der Musikgruppe Landser ist damit rechtskräftig.
Urteil vom 10. März 2005 – 3 StR 233/04
Kammergericht Berlin - 3 StE 2/02-5(1)
Karlsruhe, den 10. März 2005 |
|
|
|
|
| Bundesgerichtshof zur Verjährung von deliktsrechtlichen Schadensersatzansprüchen beim Erwerb von Wertpapieren |
13.03.2005 |
Der für das Bank- und Börsenrecht zuständige XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte darüber zu entscheiden, ob deliktsrechtliche Schadensersatzanspüche wegen Beratungsverschuldens beim Erwerb von Wertpapieren der Verjährungsregelung des § 37a WpHG unterliegen.
Der Kläger nimmt die beklagte Bank aus abgetretenem Recht auf Schadensersatz wegen eines angeblichen Beratungsverschuldens beim Erwerb von drei verschiedenen risikobehafteten Fondsanteilen am 8. Februar 2000 in Anspruch. Die Kurswerte der Fondsanteile sanken Ende 2000 deutlich, was die Käuferin zum Anlaß nahm, gegen die Beklagte und ihren Anlageberater im Januar 2001 erhebliche Vorwürfe eines Beratungsverschuldens zu erheben, die von der Beklagten zurückgewiesen wurden. Mit seiner erst am 28. Februar 2003 erhobenen Klage verlangt der Kläger aus abgetretenem Recht der Käuferin Zahlung von ca. 50.000.- € Schadensersatz Zug um Zug gegen Rückgabe der Fondsanteile. Die Beklagte beruft sich auf Verjährung nach § 37a WpHG. Die Klage ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine Anträge weiter.
Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Klägers zurückgewiesen.
Ein etwaiger Schadensersatzanspruch wegen positiver Vertragsverletzung war bei Klageerhebung bereits gemäß § 37a WpHG verjährt. Die dreijährige Verjährungsfrist dieser Vorschrift begann mit dem Schadenseintritt, der in dem Erwerb der Fondsanteile am 8. Februar 2000 und nicht erst in den späteren Kursverlusten zu sehen ist.
Die weitere Frage, ob auch ein etwaiger deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WpHG wegen fahrlässiger Beratungspflichtverletzung der Verjährungsregelung des § 37a WpHG unterliegt, hat der Senat bejaht. Zweck der im Rahmen des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes eingeführten Verjährungsregelung war, durch Verkürzung der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 Jahren dem Anlageberater eine zuverlässigere Einschätzung möglicher Haftungsansprüche zu ermöglichen und so seine Bereitschaft zu stärken, auch risikoreichere Papiere, insbesondere auch Titel junger innovativer Unternehmen, zu empfehlen. Da eine Verwirklichung des Tatbestands des § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WpHG stets auch ein vertragliches Beratungsverschulden darstellt, würde dieser Gesetzeszweck verfehlt, wenn die kurze Verjährungsfrist des § 37a WpHG bei deliktsrechtlichen Schadensersatzansprüchen wegen fahrlässiger Fehlberatung keine Anwendung fände. Für eine vorsätzliche Beratungspflichtverletzung – die im vorliegenden Fall nicht zur Entscheidung stand – verbleibt es hingegen bei der Regelverjährung für deliktsrechtliche Ersatzansprüche.
Die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Verjährung von Schadensersatzansprüchen gegen Rechtsanwälte entwickelten Grundsätze der Sekundärverjährung sind auf Fälle der Anlageberatung durch Wertpapierdienstleister mangels eines vergleichbaren dauerhaften Vertrauensverhältnisses nicht übertragbar.
Urteil vom 8. März 2005 – XI ZR 170/04
LG Berlin - 21 O 118/03 ./. KG Berlin – 19 U 71/03
Karlsruhe, den 8. März 2005 |
|
|
|
|
| Bundesgerichtshof zum Schadensersatzanspruch einer Bank nach Rückgabe einer Lastschrift mangels Kontodeckung |
13.03.2005 |
Der für das Bank- und Börsenrecht zuständige XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, daß die bundesweit einheitliche Praxis einer Bank, nach Rückgabe einer Lastschrift mangels Kontodeckung ihre Kunden mit pauschal 6 Euro Schadensersatz zu belasten, unzulässig ist.
Nachdem der XI. Zivilsenat mit Urteilen vom 21. Oktober 1997 (BGHZ 137, 43 ff. und BGH, WM 1997, 2300 ff.) Entgelte für die Rückgabe von Lastschriften mangels Kontodeckung für unzulässig erklärt hatte, wies die beklagte Großbank ihre Geschäftstellen intern an, die ihr bei Rückgabe einer Lastschrift mangels Kontodeckung entstehenden Kosten gegenüber dem Kontoinhaber teilweise als Schadensersatz geltend zu machen und dessen Konto mit 15 DM, jetzt 6 €, zu belasten. Die Beklagte verfuhr daraufhin gemäß diesem Rundschreiben. Die Kontoauszüge betroffener Kunden enthielten die Belastungsbuchung „Lastschrift-Rückgabe vom … 6 €“. Auf Beschwerden betroffener Kontoinhaber begründete die Beklagte die Kontobelastung damit, daß ihr wegen Verletzung einer den Kunden treffenden Kontodeckungspflicht ein Schadensersatzanspruch zustehe. Mit seiner Unterlassungsklage wendet sich der klagende Verbraucherverein gegen diese Praxis der Beklagten. Er ist der Auffassung, daß in der bundesweit einheitlichen Praxis der Beklagten das Verwenden einer Allgemeinen Geschäftsbedingung liege, die wegen Verstoßes gegen AGB-rechtliche Schutzvorschriften unwirksam sei. Das Landgericht (BKR 2003, 879) hat der Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht (ZIP 2004, 1496) hat sie abgewiesen.
Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und das landgerichtliche Urteil wieder hergestellt.
Die mit Rundschreiben vom 4. Mai 1998 eingeführte einheitliche Praxis der Beklagten ist zwar keine allgemeine Geschäftsbedingung. Weder die interne Anweisung vom 4. Mai 1998 noch die Belastungsbuchungen auf den Kontoauszügen noch die Schreiben an widersprechende Kunden lassen sich als Vertragsbedingung qualifizieren. Es liegt aber ein Verstoß gegen das Umgehungsverbot des § 306 a BGB vor. Mit ihrer Vorgehensweise praktiziert die Beklagte die vom erkennenden Senat in seinen Urteilen vom 21. Oktober 1997 für unzulässig und unwirksam erklärte Entgeltklausel bei der Rückgabe von Lastschriften mangels Deckung unter dem rechtlichen Deckmantel pauschalierten Schadensersatzes wirtschaftlich wirkungsgleich weiter. Die interne Anweisung der Beklagten ist ebenso effizient wie die Pauschalierung von Schadensersatz in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und hat ferner deren typischen Rationalisierungseffekt. Die Beklagte verwirklicht den einseitig auf 6 Euro festgelegten Betrag durch Belastung des Kundenkontos und Verrechnung ihrer – vermeintlichen – Forderung im Kontokorrent.
Der danach eröffneten Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB hält die interne Anweisung und die darauf beruhende Geschäftspraxis der Beklagten nicht stand. Schadensersatz kann auf vertraglicher Grundlage nur verlangt werden, wenn der Schuldner eine Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein Bankkunde ist gegenüber seiner Zahlstelle jedoch nicht verpflichtet, für die Einlösung von Lastschriften im Einzugsermächtigungsverfahren Deckung vorzuhalten. Die Schuldnerbank wird nicht auf Weisung des Schuldners tätig, sondern sie greift im Auftrag der Gläubigerbank ohne eine Weisung ihres Kunden auf dessen Konto zu. Ob der Schuldner überhaupt eine Einziehungsermächtigung erteilt hat oder im Verhältnis zu seinem Gläubiger zu der erhobenen Leistung verpflichtet ist, weiß und interessiert die Schuldnerbank aufgrund der Ausgestaltung des Lastschriftverfahrens nicht. Die Schuldnerbank kann ihre Aufwendungen, die durch die Lastschriftrückgabe mangels Deckung entstehen, im Interbankenverhältnis bei der Gläubigerbank liquidieren, wobei es die Kreditwirtschaft in der Hand hat, insoweit kostendeckende Rücklastschriftentgelte vorzusehen. Die Gläubigerbank kann ihre das Rücklastschriftengelt umfassenden Aufwendungen dem Gläubiger in Rechnung stellen, der seinerseits, falls die Lastschrifteinreichung berechtigt war, den Schuldner auf Ersatz in Anspruch nehmen kann.
Urteil vom 8. März 2005 – XI ZR 154/04
LG Köln – 26 O 100/02 ./. OLG Köln – 13 U 192/02
Karlsruhe, den 8. März 2005 |
|
|
|
|
| Verfall des Rückzahlungsanspruchs bei überzahlter Vergütung |
13.03.2005 |
Die Beklagte ist seit 1975 bei dem klagenden Land als Schreibkraft beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis findet der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) Anwendung. Nach dem Ende des Erziehungsurlaubs der Beklagten vereinbarten die Parteien die Herabsetzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 auf 19,25 Stunden ab dem 11. Dezember 1990. Das teilten die Beschäftigungsdienststelle der Beklagten und auch die Beklagte selbst dem Landesamt für Besoldung und Versorgung mit. Trotz der verminderten Wochenarbeitszeit erhielt die Beklagte die für entsprechende vollbeschäftigte Angestellte festgelegte Vergütung. Die Beschäftigungsdienststelle der Beklagten erkannte die irrtümliche Gehaltsüberzahlung am 6. Oktober 2001 und unterrichtete am 6. Dezember 2001 das für die Rückforderung zuständige Landesamt für Besoldung. Dieses verlangte erstmals mit einem Schreiben vom 27. Februar 2002 von der Beklagten die Rückzahlung der überzahlten Vergütung.
Die Klage des Landes auf Rückzahlung der von Dezember 1990 bis August 2001 an die Beklagte ohne rechtlichen Grund gezahlten Vergütung in Höhe von 113.932,97 Euro hatte beim Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. Dem klagenden Land war die verminderte Wochenarbeitszeit der Beklagten bekannt. Sein Anspruch auf Rückzahlung der überzahlten Vergütung ist deshalb im Anspruchszeitraum anteilig mit der jeweiligen Gehaltszahlung am 15. des Kalendermonats entstanden und fällig geworden. Mit der erstmaligen schriftlichen Geltendmachung des Rückzahlungsanspruchs am 27. Februar 2002 hat das klagende Land die tarifliche Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit des Anspruchs (§ 70 Satz 1 BAT) für die vor September 2001 fällig gewordenen Rückzahlungsansprüche nicht gewahrt. Der Sechste Senat konnte offen lassen, ob die Beklagte erkannt hat, dass sie Vergütungszahlungen ohne Rechtsgrund erhalten hat, und deshalb dem klagenden Land die Gehaltsüberzahlungen anzeigen musste. Selbst wenn zu Gunsten des klagenden Landes eine pflichtwidrig unterlassene Anzeige unterstellt würde, wäre der Verfall des Rückzahlungsanspruchs nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) nicht ausgeschlossen. Teilt ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber Gehaltsüberzahlungen pflichtwidrig nicht mit und erhält dieser davon anderweitig Kenntnis, beginnt eine tarifliche Ausschlussfrist nicht neu zu laufen. Vielmehr fällt nach ständiger Rechtsprechung die Einwendung einer rechtsmissbräuchlichen Berufung auf die Ausschlussfrist bereits dann weg, wenn der Arbeitgeber trotz Kenntnis des Überzahlungstatbestandes längere Zeit von einer Geltendmachung seines Rückzahlungsanspruches in der nach dem Tarifvertrag gebotenen Form absieht (vgl. BAG 13. Februar 2003 – 8 AZR 236/02 – AP BGB § 613a Nr. 244 = EzA TVG § 4 Ausschlussfristen Nr. 162 mwN). Am 27. Februar 2002 hatte das klagende Land bereits mehrere Monate Kenntnis von der Gehaltsüberzahlung. Es hat seinen Rückzahlungsanspruch damit nicht innerhalb einer kurzen Frist geltend gemacht.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 10. März 2005 - 6 AZR 217/04 -
Vorinstanz: LAG Düsseldorf, Urteil vom 14. April 2004 - 12 Sa 177/04 - |
|
|
|
|
| Ausschluss der Eltern nichtehelicher Kinder von einer Hinterbliebenenversorgung nach dem Opferentschädigungsrecht verfassungswidrig |
13.03.2005 |
Es ist mit Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichheitssatz) in Verbindung mit Art. 6
Abs. 1 GG (Schutz der Familie) unvereinbar, dass das
Opferentschädigungsgesetz (OEG) keine Versorgungsleistung für den
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft vorsieht, der nach dem
gewaltsamen Tod des anderen Lebenspartners unter Verzicht auf eine
Erwerbstätigkeit die Betreuung der gemeinsamen Kinder übernimmt. Der
Gesetzgeber ist verpflichtet, insoweit bis zum 31. März 2006 eine
verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Dies entschied der Erste Senat
des Bundesverfassungsgerichts auf die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines
nichtehelichen Vaters. Das angegriffene Urteil des Bayerischen
Landessozialgerichts wurde aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.
Rechtlicher Hintergrund und Sachverhalt:
Wer Opfer einer Gewalttat geworden ist und dadurch einen körperlichen,
geistigen oder seelischen Schaden erlitten hat, kann nach dem OEG (in
Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz) Versorgung erhalten. Dies
gilt auch für die Hinterbliebenen eines Geschädigten, der an den Folgen
der Gewalttat gestorben ist. Die Hinterbliebenenversorgung steht aber
nur der Witwe, dem Witwer, den Waisen und den Verwandten der
aufsteigenden Linie (z.B. Eltern) zu. Der Partner einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft erhält dagegen keine Hinterbliebenenversorgung. Das
OEG sieht für ihn auch dann keine Leistungen vor, wenn er nach dem
gewaltsamen Tod des anderen Lebenspartners unter Verzicht auf eine
Erwerbstätigkeit die Betreuung der gemeinsamen Kinder übernimmt.
Der Beschwerdeführer (Bf) lebte in einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft. Der Beziehung entstammen Zwillinge. Der Bf war
erwerbstätig und erwirtschaftete den Unterhalt der Familie. Seine
Partnerin betreute die Kinder. Eine Eheschließung war geplant. Sechs
Monate nach der Geburt der Kinder wurde die Partnerin des Bf ermordet.
Der Bf, der drei Jahre unbezahlten Urlaub genommen hat, um seine Kinder
zu betreuen, beantragte für sich die Gewährung einer
Hinterbliebenenrente. Der Antrag blieb im Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren ohne Erfolg. Seine Vb war erfolgreich.
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:
1. Die Vb ist zulässig. Zwar hat der Bf in den Ausgangsverfahren keine
verfassungsrechtlichen Erwägungen angestellt. Unzulässig wird dadurch
seine Vb nicht. Der Verfassungsbeschwerdeführer kann sich im
fachgerichtlichen Ausgangsverfahren regelmäßig damit begnügen, auf eine
ihm günstige Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts hinzuwirken,
ohne dass ihm daraus prozessuale Nachteile im Verfahren der
Verfassungsbeschwerde erwachsen. Es ist durch das Gebot der Erschöpfung
des Rechtswegs (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) nicht gefordert, dass er
bereits das fachgerichtliche Verfahren auch als "Verfassungsprozess"
führt.
2. Die Vb ist begründet.
Die angegriffenen Vorschriften differenzieren zwischen verheirateten und
unverheirateten Elternteilen, die nach dem gewaltsamen Tod des anderen
Elternteils gemeinsame Kinder betreuen. Bei verheirateten Eltern wird
der nach bürgerlichem Recht bestehende Anspruch eines Ehegatten auf
Unterhalt wegen Kinderbetreuung durch eine Hinterbliebenenrente nach dem
OEG abgesichert; der Anspruch eines nichtverheirateten Partners auf
Kinderbetreuungsunterhalt (§ 1615 l Abs. 2 Satz 2 BGB) wird dagegen
nicht abgesichert. Diese Unterscheidung lässt sich verfassungsrechtlich
nicht hinreichend rechtfertigen.
Zwar bestehen erhebliche rechtliche Unterschiede zwischen dem Anspruch
eines nichtehelichen Partners und dem Anspruch eines Ehegatten auf
Unterhalt wegen Kinderbetreuung. Insbesondere ist der Anspruch des
nichtehelichen Elternteils grundsätzlich auf drei Jahre befristet,
während der eheliche und nacheheliche Betreuungsunterhalt in der Regel
bis zum achten Lebensjahr des Kindes voll zu leisten ist. Diese
Unterschiede rechtfertigen aber nicht den vollständigen Ausschluss des
hinterbliebenen Elternteils eines nichtehelichen Kindes von jeglicher
Hinterbliebenenversorgung nach dem OEG. In den ersten drei Lebensjahren
eines Kindes ist ein solcher Elternteil ebenso wie der eines ehelichen
Kindes auf Unterhaltsleistungen angewiesen, wenn er in dieser Zeit das
Kind persönlich betreut. Zumindest in diesem Zeitraum ist der Anspruch
auf Betreuungsunterhalt für den nichtehelichen Partner genau so wichtig
wie für einen getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten. Darüber
hinaus ist zu berücksichtigen, dass inzwischen mehr als 20% aller Kinder
bei ihren nicht verheirateten Eltern aufwachsen. Es ist davon
auszugehen, dass der Anspruch auf Betreuungsunterhalt auch faktisch in
vielen Fällen erfüllt wird und zwar häufig wie in Ehen in Form eines
„Familienunterhalts“ in natura und auch über das dritte Lebensjahr des
Kindes hinaus. In diesem Fall bildet er einen wichtigen Baustein bei der
Absicherung desjenigen Elternteils eines nichtehelichen Kindes, der das
Kind in den ersten drei Lebensjahren betreut. Es fehlt daher an
hinreichend wichtigen Gründen, wenn der Gesetzgeber bei nicht
miteinander verheirateten Eltern - im Gegensatz zu verheirateten Eltern
- von einer Absicherung des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt durch eine
Hinterbliebenenrente nach dem OEG absieht.
Beschluss vom 9. November 2004 – 1 BvR 684/98 –
Karlsruhe, den 11. März 2005 |
|
|
|
|
| Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Aufrechterhaltung von Untersuchungshaft |
13.03.2005 |
Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Untersuchungsgefangenen, der sich
seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft befindet, gegen die
Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft war erfolgreich. Die 2. Kammer
stellte fest, dass die angegriffenen Entscheidungen des
Oberlandesgerichts (OLG) und des Landgerichts (LG) den Beschwerdeführer
in seinem Freiheitsgrundrecht verletzen. Die Sache wurde an das OLG
zurück verwiesen. Dieses hat unter Beachtung der vom
Bundesverfassungsgericht angeführten Gesichtspunkte über die
Frage der Untersuchungshaft erneut zu entscheiden.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer (Bf) befindet sich seit dem 5. August 2002 in
Untersuchungshaft. Mit Urteil vom 1. Dezember 2003 verurteilte ihn das
LG unter anderem wegen ausbeuterischer Zuhälterei und Menschenhandels zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Neben dem
Bf wurden fünf Mitangeklagte zu Freiheitsstrafen verurteilt. Gegen das
Urteil legten der Bf, die Staatsanwaltschaft und zwei der
Nebenklägerinnen Revision ein. Das LG stellte ihre Revisionsbegründungen
teilweise erst nach eineinhalb bzw. zweieinhalb Monaten der jeweiligen
Gegenpartei zu. Nach Übersendung der Akten durch die Staatsanwaltschaft
an den Generalbundesanwalt leitete dieser die Akten vier Monate später
mit einer Stellungnahme an den Bundesgerichtshof (BGH) weiter. Der BGH
bestimmte drei Wochen später, am 22. Dezember 2004, Termin zur
Hauptverhandlung über die Revisionen der zwei Nebenklägerinnen sowie der
Staatsanwaltschaft auf den 15. Juni 2005.
Mit Beschluss vom 7. Dezember 2004 wies das LG den Antrag des Bf auf
Außervollzugsetzung des Haftbefehls zurück. Das OLG verwarf seine
hiergegen gerichtete Beschwerde. Die Vb hatte Erfolg.
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:
Das Freiheitsgrundrecht (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) gebietet in Haftsachen
die angemessene Beschleunigung des Strafverfahrens. Das
Beschleunigungsgebot gilt auch nach Erlass eines erstinstanzlichen
Urteils und ist bei der Anordnung der Fortdauer von Untersuchungshaft zu
beachten.
Das OLG hat in seiner Entscheidung nicht berücksichtigt, dass Umstände
vorliegen, die den Schluss auf eine erhebliche, dem Staat zuzurechnende
vermeidbare Verfahrensverzögerung nahe legen. Zu berücksichtigen ist
hier zum einen die verzögerte Zustellung der Revisionsbegründungen.
Hinzu tritt die unter Berücksichtigung der konkreten Bearbeitungsfristen
für die Absetzung des Urteils, die Erstellung der Revisionsbegründungen
und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft sowie des
revisionsrechtlichen Prüfungsumfangs nicht nachvollziehbare lange
Bearbeitungsdauer durch den Generalbundesanwalt. Zu berücksichtigen ist
schließlich die weiträumige Bestimmung des Termins zur Hauptverhandlung
durch den BGH. Mit diesen, sich zumindest auf sieben Monate summierenden
Verzögerungen des Rechtsmittelverfahrens setzt sich das OLG nicht
hinreichend auseinander. Es gibt an Stelle der gebotenen
Einzelfallanalyse nur blankettartige Argumentationsmuster ab.
Darüber hinaus hat das OLG maßgebliche Abwägungsgrundsätze nicht
beachtet. Die verhängte Freiheitsstrafe kann nicht ohne weiteres als
Maßstab für die mögliche Länge der Untersuchungshaft dienen. In erster
Linie kommt es auf die durch objektive Kriterien bestimmte
Angemessenheit der Verfahrensdauer an. Diese kann etwa von der
Komplexität der Rechtssache, der Vielzahl der beteiligten Personen oder
dem Verhalten der Verteidigung abhängen. Allein die Schwere der Tat und
die sich daraus ergebende Straferwartung können aber bei erheblichen,
dem Staat zuzurechnenden vermeidbaren Verfahrensverzögerungen nicht zur
Rechtfertigung einer ohnehin schon lang andauernden Untersuchungshaft
herangezogen werden.
Auch die Erwägung des OLG, dass der Bf mit Wahrscheinlichkeit eine
deutlich höhere Strafe zu erwarten habe, hält einer
verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Ungeachtet der Frage, ob
eine solche Prognose im Rechtsmittelverfahren überhaupt angestellt
werden kann, fehlt es auch hier an einer hinreichenden Begründung durch
das OLG. Allein der Umstand, dass der BGH nur hinsichtlich der
Revisionen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklägerinnen, nicht aber
des Bf, Termin zur Hauptverhandlung bestimmt hat, rechtfertigt noch
keine Aussage über die Erfolgsaussichten der Revision.
Beschluss vom 22. Februar 2005 – 2 BvR 109/05 –
Karlsruhe, den 4. März 2005 |
|
|
|
|
| Asylverfahren der iranischen Staatsangehörigen Zarah K. |
03.03.2005 |
Die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Braunschweig zum Asylverfahren der iranischen Staatsangehörigen Zarah K. sind in der öffentlichen Diskussion zum Teil missverständlich, teilweise auch unzutreffend dargestellt worden.
Frau K. hatte im Dezember 2004 ihren dritten Asylantrag gestellt und dabei erstmals vorgetragen, sie sei zum Christentum übergetreten. Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge diesen Antrag abgelehnt hatte, erhob sie Klage beim Verwaltungsgericht und stellte drei Eilanträge. Zur Begründung ihres zweiten Eilantrages machte sie erstmals geltend, sie habe Ehebruch begangen. Alle Eilanträge hat der zuständige Einzelrichter abgelehnt. Ihre Klage hat Frau K. heute zurückgenommen.
In den Medien ist teilweise berichtet worden, der zuständige Richter habe entschieden, dass Frau K. trotz einer ihr im Iran drohenden geschlechtsspezifischen Verfolgung und der Gefahr der Steinigung in ihre Heimat zurückkehren müsse. Dies trifft nicht zu. Der Richter hat in seinen Entscheidungen ausdrücklich verneint, dass Frau K. wegen des behaupteten Ehebruchs und des Glaubensübertritts Gefahren für Leib oder Leben drohen. Eine Bestrafung wegen Ehebruchs setze nach dem iranischen Strafrecht voraus, dass vier Augenzeugen den Vorwurf bestätigen oder ein viermaliges Geständnis des Beschuldigten vorliege. Es sei nicht ersichtlich, dass diese Voraussetzungen erfüllt würden. Im Übrigen könne derzeit - d. h. nach dem Sachstand im Zeitpunkt der letzten Entscheidung des Gerichts am 09.02.2005 - nicht davon ausgegangen werden, dass ein Ehebruch irgendjemandem im Iran bekannt geworden sei; eine Bestrafung setze aber eine Anzeige voraus. Nach den Erkenntnissen insbesondere des Auswärtigen Amtes und des Deutschen Orient-Instituts habe die Asylbewerberin auch wegen des geltend gemachten Glaubensübertritts Verfolgungsmaßnahmen des iranischen Staates nicht zu befürchten.
Einzelheiten der Begründung können der angefügten Verfahrensübersicht entnommen werden (unter 2.).
Nicht richtig ist, dass der zuständige Einzelrichter den Vortrag von Frau K. (Glaubensübertritt und Ehebruch) in den Eilverfahren inhaltlich überhaupt nicht geprüft, sondern ihn nur als verspätet zurückgewiesen habe. Der Richter hat drei Entscheidungen im Eilverfahren getroffen. Dabei ist er auf den Vortrag der Asylbewerberin im Einzelnen eingegangen und hat auf der Grundlage sachverständiger Stellungnahmen zur Gefährdungslage im Iran entschieden, dass Frau K. keine Gefahren drohen, die einen Anspruch auf Asyl oder auf einen im Asylverfahren möglichen Abschiebungsschutz begründen können.
In der öffentlichen Diskussion ist dem Gericht teilweise vorgeworfen worden, es habe nicht geprüft, ob unabhängig von den vorgetragenen Asylgründen ein Härtefall vorliege bzw. humanitäre Gründe gegeben seien. Dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Das Gericht hat das geltende Recht anzuwenden. Gesetzgebung ist allein Aufgabe der Parlamente. Humanitäre Gründe darf das Verwaltungsgericht daher nur berücksichtigen, soweit sie gesetzlich vorgesehen sind. Die Möglichkeiten des Gerichts, seine Entscheidungen in Asylverfahren auf humanitäre Gründe zu stützen, sind nach dem geltenden Recht begrenzt. Im Asylerstverfahren oder Asylfolgeverfahren (wie dem letzten Verfahren von Frau K.) gibt es für die Berücksichtigung humanitärer Überlegungen, die über die ausdrücklich geregelten Ansprüche auf Asyl und Abschiebungsschutz hinausgehen, keine rechtliche Grundlage.
Dabei ist zu beachten, dass im Asylverfahren nicht abschließend darüber entschieden wird, ob eine Abschiebung rechtmäßig wäre. Geprüft wird nur, ob dem Asylbewerber in seinem Heimatland politische Verfolgung droht und - wenn dies verneint wird - ob so genannte zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse bestehen: Es geht also allein um die Frage, ob dem Asylbewerber in seiner Heimat Gefahren drohen, die einer Abschiebung entgegenstehen (z. B. wegen einer Erkrankung, die im Heimatland zu erheblichen Gefahren für Leib oder Leben des Asylbewerbers führen würde, weil dort die medizinische Versorgung nicht sichergestellt ist). Ob es Hindernisse gibt, die der Abschiebung als solcher entgegenstehen, hat die für die Abschiebung zuständige Ausländerbehörde zu prüfen; solche Hindernisse sind z. B. die fehlende Reisefähigkeit und familiäre Bindungen im Bundesgebiet. Hindernisse dieser Art können einen Anspruch auf Aussetzung der Abschiebung (Duldung) begründen (siehe § 60 a Abs. 2 Aufenthaltsgesetz). Lehnt die Ausländerbehörde einen dahin gehenden Antrag ab, kann beim Verwaltungsgericht Klage erhoben und der Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt werden. Ein aktuelles Verfahren dazu liegt dem VG Braunschweig in dem Fall von Frau K. nicht vor.
Die folgende Verfahrensübersicht enthält eine chronologische Darstellung der in den Asylverfahren ergangenen Entscheidungen des Gerichts und gibt die wesentliche Begründung der Entscheidungen wieder.
Übersicht zu den Asylverfahren von Frau K.
1. Die in den Jahren 2001 bis 2003 durchgeführten Verfahren
a. Erstes Asylverfahren
Den im Juni 2001 gestellten Asylantrag von Frau K. lehnte das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ab. Die hiergegen gerichtete Klage der Asylbewerberin wurde vom VG Braunschweig mit Urteil vom 27.05.2002 abgewiesen (Az. 2 A 506/01). Vortrag der Klägerin im Wesentlichen: Sie sei im Iran von den Sicherheitsbehörden gesucht worden, weil ihr Mann für die Demokratische Partei Kurdistans aktiv gewesen und sie selbst verdächtigt worden sei, für die Partei zu arbeiten. Sie sei zunächst in die Türkei ausgereist, nach 65 Tagen aber im Januar 2001 wieder in den Iran zurückgekehrt. Im Mai 2001 sei sie mit einem Visum und ihrem Pass von einem Flughafen im Iran auf dem Luftweg nach Deutschland ausgereist.
Das Gericht wies zur Begründung seines Urteils im Wesentlichen darauf hin, dass die Klägerin mit Billigung der iranischen Behörden in die Bundesrepublik habe ausreisen dürfen. Es sei "völlig unglaubhaft", dass die Ausreise mit einem Visum und ihrem Pass möglich gewesen sei, obwohl die Klägerin - wie sie behaupte - von den iranischen Sicherheitsbehörden gesucht worden sei. Dies wird im Urteil im Einzelnen ausgeführt. Die Entscheidung ist rechtskräftig.
Auch das Asylverfahren des Ehemannes hatte keinen Erfolg. Seine Klage wies das VG Braunschweig mit Urteil vom 27.05.2002 ab (Az. 2 A 523/01); Begründung im Wesentlichen: Die vorgetragene Verfolgungsgeschichte sei "frei erfunden". Den Antrag des Mannes auf Zulassung der Berufung lehnte das Nds. OVG Lüneburg ab (Beschluss vom 25.11.2002, Az. 5 LA 127/02).
b. Erstes Asylfolgeverfahren
Frau K. und ihr Ehemann stellten im Februar 2002 Folgeanträge und legten dazu ein angebliches Schreiben des islamischen Revolutionsgerichts der Stadt Marivan vor; außerdem beriefen sie sich auf exilpolitische Tätigkeiten (u. a. auf die Teilnahme an einer Demonstration im Jahre 2003). Das Bundesamt lehnte die Anträge ab.
Die hiergegen gerichtete Klage wurde vom Gericht abgewiesen (Urteil vom 11.07.2003, Az. 2 A 157/03). In der Urteilsbegründung heißt es, die in den vorherigen Urteilen geäußerten erheblichen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Kläger bestünden weiterhin. Bei dem Schreiben des Revolutionsgerichts handele es sich um eine Fälschung, weil es ein Symbol verwende, das nach Auskunftslage nur in der allgemeinen iranischen Justiz und nicht von den Revolutionsgerichten verwandt werde. Die bloße Teilnahme an einer Demonstration begründe nach der Rechtsprechung des Nds. OVG Lüneburg nicht die Gefahr politischer Verfolgung im Iran; erforderlich sei vielmehr ein Engagement in herausgehobener Funktion, an dem es hier fehle. Die Entscheidung ist rechtskräftig.
Frau K. reichte nach Abschluss dieser Verfahren beim Nds. Landtag eine Petition ein mit dem Ziel, ihr den weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport sprach sich in einer Stellungnahme vom 19.02.2004 dafür aus, dem Begehren nicht zu entsprechen. Der Ausschuss lehnte die Petition im April 2004 ab (Az. 01003/11/15).
Die im Januar 2004 vorgesehene Abschiebung konnte nicht durchgeführt werden, weil Frau K. mit ihrem Kind untertauchte.
2. Zweiter Asylfolgeantrag und im Februar 2005 abgeschlossene Eilverfahren
Einen weiteren Asylfolgeantrag stellte Frau K. am 20.12.2004 beim Bundesamt. Zur Begründung machte sie geltend, sie sei zum christlichen Glauben übergetreten. Frau K. legte die Taufbescheinigung einer Kirchengemeinde vor, in der es heißt, sie sei am 19.12.2004 getauft worden. Das Bundesamt lehnte den Asylantrag im Januar 2005 ab. Hiergegen erhob Frau K. Klage und stellte einen Eilantrag (Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung). In dem Eilverfahren hat der zuständige Einzelrichter wie folgt entschieden:
* Mit Beschluss vom 31.01.2005 (Az. 2 B 11/05) lehnte der Richter den Eilantrag ab: Entscheidend sei, dass Frau K. - wie auch das Bundesamt zutreffend ausgeführt habe - wegen des Religionsübertritts im Iran keine Verfolgung zu befürchten habe. Insbesondere sei sie nicht gehindert, ihren Glauben zu praktizieren. Dazu bezog sich der Richter auf Auskünfte des Auswärtigen Amtes und des Deutschen Orient-Instituts vom Dezember 2004 sowie des UNHCR vom August 2004. Außerdem nahm er auf den Bescheid des Bundesamtes Bezug, in dem unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ausgeführt wird, der Glaubensübertritt führe im Iran nicht zu einer staatlichen Verfolgung, sofern der Konvertierte nicht missionierend tätig werde. Die in Bezug genommene Auskunft des Auswärtigen Amtes befasst sich mit der Frage, inwieweit so genannte Apostaten (vom islamischen Glauben abgefallene und zum Christentum übergetretene Menschen) im Iran Repressalien zu befürchten haben. Wörtlich heißt es in der Auskunft:
"Auskünften kirchlicher Würdenträger zu Folge haben Apostaten, die keine Missionierung betreiben, keine staatlichen Repressalien zu befürchten." (Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 15.12.2004 an das OVG Bautzen) .
* Anfang Februar stellte Frau K. einen Antrag auf Abänderung des Beschlusses vom Januar 2005. Zur Begründung trug sie jetzt vor, sie habe sich von ihrem Ehemann getrennt. Dieser sei im Mai 2004 mit dem gemeinsamen Kind in den Iran zurückgekehrt. Sie selbst lebe in Deutschland mit einem anderen Mann zusammen. Wegen des Ehebruchs drohe ihr in ihrer Heimat die Steinigung.
Mit Beschluss vom 03.02.2005 (Az. 2 B 20/05) lehnte der zuständige Richter den Antrag ab: Es sei durch nichts belegt, dass das neue Vorbringen - der behauptete Ehebruch - den Tatsachen entspreche.
* Wenige Tage später (am 07.02.) stellte Frau K. einen weiteren Eilantrag bei Gericht. Dazu legte sie eine schriftliche Erklärung des Herrn P. R. vor, in der es u. a. heißt, nachdem er und Frau K. sich im Dezember 2004 wiedergesehen hätten, sei zwischen ihnen eine "innige Liebesbeziehung" entstanden. Außerdem reichte sie mehrere Erklärungen (u. a. von Pastoren) zu dem geltend gemachten Glaubensübertritt sowie verschiedene Zeitungsartikel ein, in denen über einen Glaubensübertritt und Ehebruch von Frau K. berichtet wird.
Diesen Antrag lehnte der zuständige Richter mit Beschluss vom 09.02.2005 ab (Az. 2 B 23/05). Zur Begründung führte er aus, es seien keine neuen Tatsachen vorgetragen worden, sodass kein Anlass bestehe, die bereits ergangenen Beschlüsse zu ändern. Im Hinblick auf den von der Antragstellerin behaupteten Übertritt zum christlichen Glauben gelte das, was das Gericht bereits in seinem Beschluss vom 31.01.2005 ausgeführt habe. Zu der Behauptung der Antragstellerin, sie habe Ehebruch begangen, weist der Richter in dem Beschluss darauf hin, es sei jedenfalls nicht ersichtlich, dass die Voraussetzungen erfüllt seien, unter denen es nach dem iranischen Strafgesetzbuch zu der von der Antragstellerin befürchteten Bestrafung kommen könne. Insbesondere verlange das iranische Strafrecht, dass vier Augenzeugen den Vorwurf bestätigten oder ein viermaliges Geständnis der Beschuldigten vorliege. Im Übrigen setze eine Bestrafung voraus, dass eine Anzeige wegen Ehebruchs erfolge. Nach den Umständen des Falles könne derzeit jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass irgendjemand im Iran von einem Ehebruch der Antragstellerin erfahren habe.
Dies war die bislang letzte Entscheidung des Verwaltungsgerichts zum Verfahren von Frau K. Die im Eilverfahren ergangenen Beschlüsse sind unanfechtbar (§ 80 des Asylverfahrensgesetzes).
Die von Frau K. gegen den Beschluss vom 09.02.2005 beim Bundesverfassungsgericht erhobene Verfassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg (Beschluss des Verfassungsgerichts vom 10.02.2005, Az. 2 BvR 225/05). |
|
|
|
|
| Kein Schadensersatz bei Unfall mit Fahrrad wenn Eisbildung auf der Straße erkennbar |
03.03.2005 |
Entscheidung der 8. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück vom 13.12.2004 (8 O 814/04)
Fahrradunfälle auf spiegelglatter Fahrbahn begründen nicht in jedem Fall einen Schadensersatzanspruch gegen die Stadt wegen nicht durchgeführter Abstreuungen der Straße. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung der 8. Zivilkammer.
In dem Rechtsstreit befuhr die Klägerin am 04.02.2003 morgens gegen 9.15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Augustenburger Straße in Osnabrück in Richtung Heger-Tor-Wall/Universität. Kurz hinter der Einmündung Maschstraße, wo die Augustenburger Straße als Fahrradstraße ausgewiesen ist, kam sie infolge Eisglätte mit ihrem Fahrrad zu Fall und zog sich u. a. eine Fraktur des linken Handgelenkes zu. Sie verlangte mit der Klage ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.200,00 Euro sowie Ersatz des eingetretenen Haushaushaltsführungsschadens, weil sie über einen Zeitraum von einem Monat ihre Wohnung nicht selber reinigen konnte. Zur Begründung führte sie aus, dass die beklagte Stadt verpflichtet gewesen wäre, wegen der besonderen baulichen Beschaffenheit der Fahrradstraße und des regen Fahrradverkehrs zu streuen. Auf der Straße hätte sich eine dünne Schneeschicht befunden. Sie habe nicht damit rechnen müssen, dass sich unterhalb der Schneeschicht eine Eisdecke gebildet hätte.
Das Gericht hat die Klage nach Vernehmung von zwei Zeugen mit der Begründung abgewiesen, dass letztlich dahinstehen könnte, ob die Stadt tatsächlich verpflichtet gewesen wäre, im Bereich der Augustenburger Straße zu streuen. Denn die Klägerin träfe an dem Unfall ein überwiegendes Mitverschulden, was einen Schadensersatzanspruch ausschlösse.
Die Kammer hat sich dabei maßgeblich auf die Aussage eines Zeugen gestützt. Dieser hatte angegeben, dass in dem fraglichen Bereich an mehreren Stellen spiegelglatte Eisflächen vorhanden gewesen wären. Es hätte Schneematsch gegeben, der zum Teil gefroren gewesen sei. Nach Auffassung des Zeugen sei es an diesem Tag relativ riskant gewesen, mit einem Fahrrad zu fahren.
Vor dem Hintergrund dieser Angaben hat das Gericht die Auffassung vertreten, dass die Klägerin nicht nur vor dem Antritt der Fahrt, sondern auch unterwegs verpflichtet gewesen wäre, die Straßenverhältnisse zu überprüfen. Sie hätte dann feststellen können, dass unter der von ihr wahrgenommenen Schneedecke sich zumindestens stellenweise Eisschichten gebildet hatten. Ein aufmerksamer und sorgfältiger Verkehrsteilnehmer wäre dann nicht weitergefahren. Das Verhalten der Klägerin sei dagegen als grob sorgfaltswidrig zu werten, zumal die Augustenburger Straße im Unfallbereich infolge der baulichen Gestaltung kurvenreich und damit für Fahrradfahrer bei Glätte besonders gefährlich sei. |
|
|
|
|
| Klage auf Ausnahme vom deutschen Reinheitsgebot erfolgreich |
03.03.2005 |
Das Bundesverwaltungsgericht hat der Klage einer brandenburgischen Brauerei stattgegeben, ihr die Herstellung eines unter Abweichung vom deutschen Reinheitsgebot gebrauten Bieres und dessen Vertrieb unter der Bezeichnung "Bier" zu genehmigen.
Die Klägerin braut unter Verwendung von Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser ein untergäriges Schwarzbier, dem sie nach erfolgter Filtrierung Invertzuckersirup zusetzt. Ihren Antrag, ihr die Herstellung dieses Getränks und sein Inverkehrbringen als Bier zu genehmigen, lehnte der Beklagte ab. Zur Begründung hieß es, als Bier dürften untergärige Getränke nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie - gemäß dem deutschen Reinheitsgebot - ausschließlich aus Gerstenmalz, Wasser, Hopfen und Hefe hergestellt seien. Demgegenüber beruft sich die Klägerin auf eine Bestimmung, derzufolge die Herstellung besonderer Biere zugelassen werden kann.
Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat die Klage abgewiesen. Eine derartige Genehmigung komme nur bei Zugabe von Gewürzen usw. in Betracht, nicht aber bei Verwendung von Zucker, der ein typischer Malzersatzstoff sei. Selbst wenn die Herstellung des Getränks erlaubt werden könnte, so dürfe es doch nicht unter der Bezeichnung "Bier" in Verkehr gebracht werden. Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der Klägerin, die vor allem in Zweifel zieht, ob der Gesetzgeber das Herstellen von Bier, das nicht nach dem Reinheitsgebot erfolge, überhaupt noch verbieten dürfe.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil des Verwaltungsgerichts geändert und der Klage stattgegeben. Dabei hat es die Einwände gegen das Reinheitsgebot dahinstehen lassen. Richtig sei, dass das Reinheitsgebot nicht dem Gesundheitsschutz diene, sondern der Traditionspflege – der deutschen Braukunst – und einem bestimmten Produktniveau. Diese Zwecke könnten eine Einschränkung der Berufsfreiheit der Klägerin nur rechtfertigen, wenn über Ausnahmen großzügig entschieden werde. Im Falle der Klägerin müsse eine Genehmigung erteilt werden. Ihr Getränk werde ohne Ersatzstoffe gebraut, insbesondere werde Gerstenmalz nicht durch Zucker ersetzt. Erst nach der Filtrierung werde aus geschmacklichen Gründen Zucker zugesetzt. Derartige Getränke sehe das Gesetz als "besondere Biere" an.
Dürfe die Klägerin aber ihr Getränk herstellen, so dürfe sie es auch unter der Bezeichnung "Bier" vertreiben. Die gesetzlichen Vorschriften über die Kennzeichnung dienten dem Schutz des Verbrauchers vor Täuschung. Es stelle aber gerade eine Täuschung dar, wenn ein Getränk, das Bier sei und als "besonderes Bier" hergestellt werden dürfe, nur unter einer Bezeichnung vermarktet werden dürfte, die jede Nähe zu Bier vermeidet. Dass das Getränk unter Abweichung vom Reinheitsgebot hergestellt sei, könne auf andere Weise deutlich gemacht werden.
BVerwG 3 C 5.04 – Urteil vom 24. Februar 2005 |
|
|
|
|
| Einführung von islamischem Religionsunterricht an öffentlichen Schulen |
03.03.2005 |
Das Bundesverwaltungsgericht hat heute über die Einführung von islamischem Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Land Nordrhein-Westfalen entschieden.
Die beiden Kläger sind Dachverbände in Form eingetragener Vereine, in welchen jeweils zahlreiche islamische Vereine mit bundesweitem oder regionalem Tätigkeitsbereich zusammengeschlossen sind. Sie verlangen vom beklagten Land die Einführung islamischen Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung im Wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, bei den Klägern handele es sich nicht um Religionsgemeinschaften im Sinne von Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG), weil sie keine Vereinigungen von natürlichen Personen seien und bei ihnen eine umfassende Pflege religiöser Angelegenheiten nicht stattfinde.
Dem ist der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts in seinem heutigen Urteil nicht gefolgt. Nach Art. 7 Abs. 3 Satz 1 GG ist der Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG bestimmt weiter, dass unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird. Durch diese Regelung wird den Religionsgemeinschaften ein Rechtsanspruch gegen den Staat auf Einführung von Religionsunterricht an seinen Schulen eingeräumt. Unter Religionsgemeinschaft ist dabei ein Verband zu verstehen, der die Angehörigen eines Glaubensbekenntnisses oder mehrerer verwandter Glaubensbekenntnisse zur allseitigen Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben zusammenfasst. Weil das Glaubensbekenntnis eine höchstpersönliche Angelegenheit ist, muss eine Gemeinschaft auf natürliche Personen zurückzuführen sein, um als Religionsgemeinschaft angesehen werden zu können. Die Voraussetzungen einer Religionsgemeinschaft können auch bei einem mehrstufigen Verband (Dachverbandsorganisation) erfüllt sein, in welchem die Gläubigen auf der örtlichen Ebene Vereine gebildet haben, die sich zu regionalen Verbänden zusammengeschlossen haben, welche wiederum einen landes- oder bundesweiten Verband gegründet haben. In einem solchen Fall bilden die Konfessionsangehörigen, die sich zum Zwecke gemeinsamer Religionsausübung in lokalen Vereinen zusammengeschlossen haben, die für das Bestehen einer Religionsgemeinschaft unentbehrliche personale Grundlage. Die allseitige Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben erfolgt arbeitsteilig auf den verschiedenen Ebenen des Verbandes. Ein Dachverband ist freilich nicht bereits dann Teil einer Religionsgemeinschaft, wenn sich die Aufgabenwahrnehmung auf seiner Ebene auf die Vertretung gemeinsamer Interessen nach außen oder auf die Koordinierung von Tätigkeiten der Mitgliedsvereine beschränkt. Vielmehr ist darüber hinaus erforderlich, dass für die Identität einer Religionsgemeinschaft wesentliche Aufgaben auch auf der Dachverbandsebene wahrgenommen werden. Ferner muss die Tätigkeit des Dachverbands in der Weise auf die Gläubigen in den örtlichen Vereinen bezogen sein, dass sie sich als Teil eines gemeinsamen, alle diese Gläubige umfassenden Glaubensvollzugs darstellt. Hieran kann es fehlen, wenn dem Verband im erheblichen Umfang Mitgliedsvereine angehören, die religiöse Aufgaben nicht oder nur partiell erfüllen.
Ob die Kläger nach diesem Maßstab als Religionsgemeinschaften anzusehen sind, konnte der Senat anhand der vom Oberverwaltungsgericht getroffenen Feststellungen nicht abschließend beurteilen. Zwar kommen die Mitglieder der auf der örtlichen Ebene bestehenden Moscheevereine als personale Zentren einer Religionsgemeinschaft in Betracht. Es ist jedoch bislang nicht hinreichend geklärt, ob die beiden Gesamtverbände nicht durch andere, auf berufsmäßiger oder sozialer Grundlage bestehende Mitgliedsverbände der Kläger geprägt werden. Gleiches gilt für die Frage, ob die klagenden Dachverbände über die bloße Interessenvertretung oder Aufgabenkoordinierung hinaus wesentliche durch die gemeinsamen religiösen Überzeugungen gestellte Aufgaben selbständig gestalten. Schon aus diesem Grunde musste das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das Oberverwaltungsgericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen werden. Sollte dieses nach entsprechender Sachaufklärung den Klägern den Charakter von Religionsgemeinschaften zuerkennen, so wird es weiter zu prüfen haben, ob die Kläger als Partner eines vom Staat veranstalteten Religionsunterrichts deswegen ausscheiden, weil gegen ihre Eignung wie vom beklagten Land geltend gemacht unter dem Gesichtspunkt der Verfassungstreue Bedenken bestehen. Maßstab sind dabei insbesondere die in Art. 79 Abs. 3 GG in Bezug genommenen Grundsätze der Menschenwürde und des demokratischen Rechtsstaats. Die Einhaltung dieser Grundsätze kann der Staat von Religionsgemeinschaften erwarten, die mit ihm bei der religiösen Unterweisung von Schulkindern zusammenarbeiten wollen.
BVerwG 6 C 2.04 – Urteil vom 23. Februar 2005 |
|
|
|
|
| Zum Anspruch eines Mieters auf Anbringung einer Parabolantenne |
03.03.2005 |
Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute über den Anspruch eines Mieters gegen den Vermieter auf Duldung der Anbringung einer Parabolantenne entschieden.
Der Kläger, ein russischer Staatsangehöriger, ist Mieter einer Wohnung in einem der Beklagten gehörenden Mehrparteienhaus in Calbe. Die Wohnung ist mit einem Kabelanschluß für den Empfang von Radio und Fernsehprogrammen versehen. Durch Installation eines zusätzlichen Decoders könnten über "Digi-KABEL RUS" fünf russische Programme empfangen werden. Die Beklagte hat dem Kläger freigestellt, auf seine Kosten einen solchen Decoder anzuschließen. Der Kläger möchte dagegen mit Hilfe einer Parabolantenne, die er an dem Metallgitter vor dem Fenster seines Wohnzimmers im dritten Stock des Anwesens anbringen will, eine größere Zahl privater und staatlicher russischer Fernsehprogramme empfangen. Die beklagte Vermieterin verweigerte ihr Einverständnis hierzu.
Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, die Installation einer Parabolantenne mit einem Durchmesser von höchstens 80 cm zu dulden. Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen und die Revision zugelassen.
Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Klägers zurückgewiesen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dem Grundrecht des Mieters aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 GG, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, auch in zivilgerichtlichen Streitigkeiten über die Anbringung von Sattelitenempfangsanlagen an Mietwohnungen Rechnung zu tragen. Andererseits ist zu berücksichtigen, daß das Grundrecht des Vermieters aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG berührt ist, wenn von ihm verlangt wird, eine Empfangsanlage an seinem Eigentum zu dulden. Das erfordert in der Regel eine fallbezogene Abwägung der von dem eingeschränkten Grundrecht und dem grundrechtsbeschränkenden Gesetz geschützten Interessen. Dabei ist das besondere Informationsinteresse von dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländern zu beachten. Diese haben ein anerkennenswertes Interesse, die Programme ihres Heimatlandes zu empfangen, um sich über das dortige Geschehen unterrichten und die kulturelle und sprachliche Verbindung aufrechterhalten zu können. Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht bei seiner Abwägung beachtet. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß der Kläger über das Programmpaket "Digi-KABEL RUS" bereits fünf russischsprachige Sender über das im Gebäude installierte Breitbandkabel nach Erwerb eines Zusatzgerätes empfangen kann. Unter diesen Gegebenheiten hat es dem Eigentumsrecht der Beklagten den Vorrang eingeräumt mit der Begründung, das Gesamtbild der Gebäudefassade würde durch das Einbringen einer Parabolantenne erheblich beeinträchtigt, auch wenn der Eingriff in die Gebäudesubstanz gering sein könne. Diese Abwägung des Berufungsgerichts ließ einen Rechtsfehler nicht erkennen, so daß die Revision des Klägers zurückzuweisen war.
Urteil vom 2. März 2005 ‑ VIII ZR 118/04
AG Schönebeck - 4 C 111/03 (III) ./. LG Magdeburg - 12 S 327/03 (118)
Karlsruhe, den 2. März 2005 |
|
|
|
|
|
|